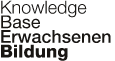Ein anderer Zirkus. Science in fiction: Die Welt der Wissenschaft in der Literatur
Titelvollanzeige
| Autor/in: | Malina, Peter |
|---|---|
| Titel: | Ein anderer Zirkus. Science in fiction: Die Welt der Wissenschaft in der Literatur |
| Jahr: | 1996 |
| Quelle: | Spurensuche. Zeitschrift für Geschichte der Erwachsenenbildung und Wissenschaftspopularisierung, 1996, H. 3/4, S. 18-34. |
"Wissenschaft wird inmitten einer Stammeskultur betrieben, deren Angehörigen es im allgemeinen widerstrebt, ihre Stammesgeheimnisse zu verraten" (Djerassi 1995, 7).
Anfang der 70er Jahre stieß ich per Zufall auf den Titel eines Taschenbuches, der mich an die Lesefrüchte meiner Schulzeit erinnerte: "Walden zwei/Futurum zwei", sein Autor: Burhues F. Skinner, ein Star der Verhaltenspädagogik und Lerntheorie. Die Erinnerung an Henry David Thoreaus "Walden or Life in the Woods" lag auf der Hand, der Autor des Remakes allerdings war mir damals nur konturenhaft bekannt. "Futurum zwei" ist eine Utopie, in der Skinner seine (wissenschaftlichen) Visionen von einem aggressionsfreien Zusammenleben von Menschen darstellte. Etwa zur gleichen Zeit bekam ich einen Text des Erziehungswissenschaftlers Horst Rumpf zu Gesicht und fand hier in Form eines fiktiven Tagebuchs eine Utopie einer Schule vor, in der die Ergebnisse der Bildungsdiskussion der Bundesrepublik Realität geworden sind.
Wissenschaft zu popularisieren gehört nicht unbedingt zu den Anliegen der Wissenschaft; und in die Niederungen des Lebens herabzusteigen, fällt Wissenschaftlern wohl auch deswegen schwer, weil sie selbst sich mitunter recht mühselig im Verlaufe ihrer Karriere aus den "Niederungen" des gewöhnlichen Lebens in die Höhen des gesellschaftlichen/sozialen Erfolgs hinaufgearbeitet haben und den vermeintlichen "Abstieg" in die Niederungen des Populären fürchten. Dazu kommt wohl auch, daß "verständlich" schreiben, so daß es Spaß macht, das Geschrieben auch zu lesen – und dies mit Interesse und Vergnügen – in der kopflastigen Wissenschaftstradition Deutschlands/Österreichs weder vorgesehen noch notwendig ist.
Das Lesen schwieriger Texte (ich denke mit Schaudern an meine ersten Begegnungen mit den Texten von Karl Rahner, Jürgen Habermas oder Herbert Marcuse) fällt mir schon lange nicht schwer, ich bin es gewohnt, "Schwieriges" und "Unverständliches" zu lesen. Die Sehnsucht nach "lebendiger" Wissen[S: 18]schaft aber ist geblieben. Der folgende Beitrag versteht sich als ein gewiß unvollständiger und sehr subjektiver Bericht über die Begegnung mit solchen Texten, in denen von "Wissenschaft" und "Wissenschaftlern" so die Rede ist, daß das Vergnügen am Weiterlesen erhalten bleibt. Sein Ziel ist es also nicht, die Gattung "Wissenschaftsroman" erschöpfend zu behandeln – dazu liegen zumindest für den angelsächsischen Campus-Roman schon einige recht interessante Untersuchungen vor. Hier geht es vor allem darum, nachzuspüren, wie Wissenschaft und Wissenschaftler in fiktionalen/außerwissenschaftlichen Texten in Erscheinung treten und welcher Wissens- "Gewinn" aus diesen Texten – abgesehen von ihrem Unterhaltungswert – gezogen werden kann.
1. Das Schreiben über Wissenschaft: "Science in Fiction"
" ... und ob Sie es glauben oder nicht, das Wall Street Journal verhindert bei Pyrrhocoris apterus tatsächlich die sexuelle Entwicklung und führt zu seinem vorzeitigen Tod, während die London Times unschädlich ist" (Djerassi 1995, 285-286).
In den letzten Jahren hat auch in der deutschsprachigen Literatur der Wissenschaftsroman seinen Platz und seine Leser gefunden. Dieter Schwanitz hat mit seinem Roman "Campus" einen Typus von Literatur eingebracht, der im angelsächsischen Bereich eine lange Tradition hat. Was Inhalt und Struktur dieser Romane betrifft, so hat Wolfgang Weiss in seiner Studie über den angelsächsischen Universitätsroman folgende Begriffsbestimmung vorgeschlagen: "Da der Universitätsroman sich jeweils explizit auf die Institution Universität in der gesellschaftlichen Wirklichkeit bezieht, ist sein wichtigstes konstitutives Merkmal, daß wesentliche Züge dieser Institution, sei es in realistischer Mimesis, die bis zur exakten Beschreibung einer realen Universität gehen kann, sei es in stilisierender, modellhafter Darstellung einschließlich karikaturistischer Übertreibung oder satirischer Verzerrung in den fiktionalen Gesamtentwurf der Handlungswelt des Romans eingebracht werden. Zu diesen Zügen gehört das Nebeneinander zweier funktional voneinander getrennter Gruppen, der Studierenden und der Dozenten, die Hierarchie des [S. 19] Lehrkörpers und die relativ starke Abgeschlossenheit gegenüber der gesamten Gesellschaft, für die die Universität jedoch gleichzeitig eine wichtige Funktion hat. Aus dem Aufeinandertreffen der beiden Gruppen, die das soziale Gefüge der Universität konstituieren, können nicht nur die verschiedensten Handlungssequenzen entfaltet werden, sondern durch sie kommt es auch zu den Varianten der student-centred novel und der staff-centred novel (...), wobei jeweils eine Gruppe mehr oder weniger schematisch skizziert oder ganz ausgeblendet wird" (Weiss 1994, 20-21).
Per Literatur lernt der Leser in diesen Wissenschaftsromanen Wissenschaft und Wissenschaftler und ihr "kleines" Leben – zum Teil aus durchaus authentischer Sicht – kennen. Die Verfasser der Texte kommen in vielen Fällen aus der Wissenschaft selbst. Sie beschreiben in ihren Büchern ihre eigene Arbeitswelt: Malcolm Bradbury ist Professor für Anglistik, Carl Djerassi war Professor für Biochemie, Amanda Cross lehrt Literaturwissenschaft an der Columbia University. Auch die "Helden" der Geschichten sind vielfach Universitätsabsolventen oder gar Professoren: der Erzähler in Bradburys "Doctor Criminale" hat Literaturwissenschaft studiert; Charlotte MacLeods Peter Shandy ist Professor für Nutzpflanzenzucht an einer Landwirtschaftlichen Hochschule, und in Keith Oatleys "Emily V." ist es gar Professor Freud persönlich, der über den Fall einer Patientin berichtet.
"Wissenschaft und Literatur" – so hat es Hans-Jürgen Heinrichs in seinen Überlegungen zur "Erzählten Welt" formuliert – eröffnen jeweils verschiedene Zugänge zur Wirklichkeit: "Wo sich diese Zugangsweisen (...) überschneiden und überblenden, besteht die größte Wahrscheinlichkeit, Wirklichkeit komplexer zu verstehen als in der Separierung und Erstarrung der Disziplinen" (Heinrichs 1996, 17-18). Wissenschaftsromane eröffnen eine Innenansicht eines sonst der Öffentlichkeit eher verborgenen Lebensbereichs. Ihre Faszination beruht auch darauf, daß diese Romane wissenschaftliche Arbeit als Spurensuche beziehungsweise als Enthüllung von "Geheimnissen" präsentieren: bei Barbara Wood beispielsweise ist es eine Schriftrolle, die seit fast 2.000 Jahren in einem Tonkrug verborgen war, und nun in einem mühsamen Verfahren entziffert wird. Ganz nebenbei erhält der Leser aber auch einen Einblick in Schwierigkeiten des Transkribierens alter Schriften (Wood 1994). Malcolm Bradburys "Doctor Criminale" ist vordergründig eine spannende Enthüllungsgeschichte, in der es darum geht, der Lebensgeschichte eines prominenten Wissenschschaftlers nachzuspüren. Gleichzeitig aber ist sie auch ein amüsanter Beitrag zur Kritik der Konstitutionsbedingungen von Forschung in einer auf Starkult und Medienwirksamkeit bestimmten Unterhaltungsgesellschaft. Frigga Haugs "Jedem nach seiner Leistung" ist zunächst einmal die Geschichte der Aufdeckung eines Mordes. Bestimmend für die Handlung [S. 20] (und Auslöser des Mordfalls) aber sind die Leistungs- und Konkurrenzverhältnisse, die Studenten wie Professoren in ihren universitären wie privaten Lebensverhältnissen bestimmen.
Um Wissenschaft zu beschreiben, ist es notwendig, den Bereich der Wissenschaft zu verlassen und das Umfeld von Leben in/für Wissenschaft in die Geschichten einzubeziehen. Carl Djerassi hat sich nach seiner Emeritierung als Professor der Literatur zugewandt. Auslösende Ursache dafür war ein sehr privates Trennungserlebnis: "Ich, der ich noch nie ein Gedicht oder etwas Belletristisches beschrieben hatte, beschloß, mich an dieser ausgezeichneten Dichterin und Literaturprofessorin in ihrem eigenen Revier zu rächen" (Djerassi 1996, 535). Ergebnis dieses neuen Anfangs war unter anderem der Roman "Cantors Dilemma", mit dem Djerassi seine wissenschaftlichen (Lebens-)Erfahrungen in die Literatur als "science in fiction" einbrachte (Djerassi 1996, 538).
Auch für Professor Skinner waren sehr konkrete lebensgeschichtliche Erfahrungen der Anlaß dafür, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse in einer Geschichte festzuhalten. Auch bei ihm waren es – wie er im Vorwort zu der Ausgabe von "Futurum zwei" (1976) schreibt – seine konkreten Lebensumstände gewesen, die wesentlich auch mit seinem privaten wie wissenschaftlichen Leben zusammenhingen: "Die Mißhelligkeiten, die mich zur Abfassung von 'Walden Two' bewogen hatten, waren persönlicher Natur. Ich war Zeuge, wie sich meine Frau und ihre Freundinnen gegen die Haushaltsverpflichtungen wehrten und wie sie zähneknirschend in die Rubrik 'Berufsstand' auf Formularen das Wort 'Hausfrau' eintrugen. Unsere älteste Tochter hatte eben ihre erste Prüfung bestanden, und das erste Schuljahr eines Kindes bringt einen wie nichts anderes auf das Thema Erziehung" (Skinner 1988, 5). Insbesondere auch seine wissenschaftliche Position hatte ihn in dieser privaten Umbruchssituation bewogen, seine wissenschaftlichen Erfahrungen in eine konkrete Beschreibung einzubringen: "Ich hatte gerade ein fruchtbares Jahr bei einer Guggenheim-Stiftung hinter mir, hatte aber die Leitung eines Departments der University of Indiana übernommen und würde vielleicht nicht so bald wieder Zeit für Forschung und Lehre haben. Konnte ich nicht irgendwie an Problemen dieser Art arbeiten? Gab es hier keine Möglichkeiten für die Verhaltenswissenschaft?" (Skinner 1988, 5)
Djerassi wie Skinner, aber auch Rumpf schrieben ihre Romane auf dem Hintergrund ihrer eigenen wissenschaftlichen Alltagserfahrungen, die sie in oft erstaunlich präzisen Details wiedergeben. Manche Details ihrer Geschichten mögen für den Nichtfachmann zwar amüsant, manchmal aber auch "erfunden" erscheinen. Im Nachwort zu "Cantors Dilemma" hat Carl Djerassi sein literarisches Verfahren so beschrieben: "Aber dieses Buch ist auch keine Science fiction. Beispielsweise stimmt im wesentlichen jedes Detail über Insekten: Männliche Skorpionsfliegen legen wirklich das Verhalten von Transvestiten an den Tag, das Sexualverhalten der weiblichen Furchenbiene wird in der Tat durch einen chemischen Keuschheitsgürtel eingeschränkt; und ob Sie es glauben oder nicht, das Wall Street Journal verhindert bei Pyrrhocoris apterus tatsächlich die sexuelle Entwicklung und führt zu seinem vorzeitigen Tod, während die London Times unschädlich ist" (Djerassi 1995, 285-286). [S. 21]
2. Wissenschafter-Typologien: "Wesen, die das Glück haben, jeden Tag das zu tun, was sie am liebsten tun"
"... In einer Welt der Ahnungslosen sind Professoren Menschen, die darauf brennen, jeden Morgen selbstlos die Suche nach Erklärungen für die Rätsel dieser Welt zu beginnen. Sie betreten liebenswürdig und heiter die Oasen ihres Wissens, wo alles blüht und gedeiht. Sie gelten als Wesen, die das Glück haben, jeden Tag das zu tun, was sie am liebsten tun und am besten können, und dafür auch noch gut bezahlt werden" (Camartin 1994, 234).
Wissenschaft ist stets Wissenschaft "von" Menschen. Jürgen Mittelstraß hat als signifikant für die wissenschaftliche Lebensform im Anschluß an ein Zitat aus Johann Gottlieb Fichtes Jenaer Vorlesung aus dem Jahre 1794 das "unordentliche Leben" des Wissenschaftlers angeführt, der – von Nachbarn manchmal tadelnd bemerkt – "häufig erst aufsteht, wenn andere Berufstätige schon wieder müde werden, der aber, von den Nachbarn in der Regel leider unbemerkt, häufig erst mit dem ersten Hahnenschrei Schreibtisch und Labor verläßt". Dazu kommen "ein Übermaß an Eitelkeit (die Aufträge, ehrenvolle zumal, schlecht abschlagen läßt), Bürokratisierung wissenschaftlicher Verhältnisse, Karrierezwänge" (Mittelstrass 1982, 27). Iso Camartin hingegen hat in seiner (imaginären) "Bibliothek von Pila" die Spezies "Professor" und ihr Leben so beschrieben: "Mit der Zeit werden sie so gelehrt und belesen, daß sie erste Hinweise schon haben, bevor sie die Fragen gehört haben, die man ihnen stellt. Sie sind unermüdlich in den Details und unersättlich in der Anhäufung jener Nebensächlichkeiten, die ihre Reden so umständlich und ihre Schriften so voluminös machen. Von der universellen Bedeutung ihrer Lehr- und Forschungsspezialität sind sie so überzeugt, daß ihnen völlig unverständlich ist, wie jemand Mensch sein kann, ohne von ihrer Arbeit Notiz zu nehmen (...)" (Camartin 1994, 234).
Dieter Schwanitz ortet in seinem "Campus"-Roman fünf Typen von Professoren: "die triebverzichtlerische Fan-Natur (...) der fähige Wissenschaftler, der vielleicht eine Ergänzung braucht, aber auf keinen Fall einen Konkurrenten oder eine Berühmtheit, die seine eigene Leuchtkraft verblassen läßt (...) der liberale, bequeme (...), der hat seinen wissenschaftlichen Ehrgeiz aufgegeben, lehrt nur noch Seminare und hat sich ins Privatleben zurückgezogen (...) der fünfte Typ ist der Schlimmste (...) das ist die beschränkte, ständig überforderte Zwergengestalt mit dem dumpfen Wissen um ihre mangelnde Begabung. Ihn erfüllt das Ressentiment des Zukurzgekommenen gegen alle und jeden, der mehr als nur mittelmäßig ist" (Schwanitz 1995, 70-71).
In Alan Lightmans Roman "Der gute Benito" machen wir die Bekanntschaft mit einem Physiker, der ganz in seiner Wissenschaft lebt und dabei das "Leben" außerhalb seiner Wissenschaft aus dem Blick verliert. Seine Wissenschaft ereignet sich fern ab der Welt, in der Skurrilität der Verschrobenheit vor sich hin denkender, lediglich an einem interessierter Wissenschaftler, die permanent im Training [S. 22] bleiben müssen, um mit den Entwicklungen mithalten zu können: "jeder ernsthafte Physiker unter vierzig (...) verschlang die Wissenschaft. Nach vierzig konnte ein theoretischer Physiker es ein bißchen laufen lassen, einem Hobby frönen oder sich seiner Familie widmen. Aber bis dahin war an Kürzertreten nicht zu denken. Besessenheit gehörte zum Ethos" (Lightman 1996, 154).
In der Welt des Physikers Bennett werden Studenten von genialen Professoren ausgewählt wie "Jünger". Um in die Schar der Erwählten aufgenommen zu werden, sind allerdings bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Ein Kriterium für die Aufnahme ist die Beantwortung der Frage: "Gesetzt, ein reibungsloser Käfer rutscht im Uhrzeigersinn, von der Zwölf-Uhr-Position aus, auf den reibungslosen Rand einer Uhr entlang: bei welcher Stundenmarkierung wird er herunterfallen?" (Lightman 1996, 143-144). Bennett erfährt in seiner wissenschaftlichen Arbeit die Aufregung geradezu "märchenhafter" Berechnungen, und nach und nach bestätigte sich sein Verdacht, daß die Welt durch Gleichungen beschrieben werde: "Er berechnete die Raleigh Streuung, die die Bläue des Himmels erklärte, das gravitative Drehmoment, das die Präzision der Äquinoktialpunkte erklärte, die Quantenwahrscheinlichkeit dafür, daß ein Alphateilchen in einen Atomkern eindrang. Bisweilen berechnete er zum Spaß auch prosaische Phänomene wie die Trajektorie eines Papierknäules" (Lightman 1996, 152). Die Faszination von Wissenschaft und die schmerzliche Erfahrung, im Wissenschaftsbetrieb nicht mehr (so) verankert sein zu können, hat Carl Djerassi in seinem zweiten Wissenschaftsroman "Das Bourbaki-Gambit" beschrieben. Hier geht es um eine Gruppe emeritierter Wissenschaftler, die zur Kenntnis nehmen müssen, daß sie im Hochschulbereich nicht mehr so weiterleben können wie bisher. Um sich am wissenschaftlichen Establishment zu rächen, das sie nicht mehr brauchen kann, erfinden sie eine junge Wissenschaftlerin, unter deren Namen ihre wissenschaftlichen Arbeiten nun erscheinen – und dabei das Pech haben, daß ihr Phantom mit ihren Publikationen so erfolgreich ist, daß sie schließlich ihr Experiment abbrechen müssen.
3. Wissenschaft als Selbstdarstellung: "Müssen die sich immer noch vor ihren Mamis und Papis produzieren?"
"Ich hatte jetzt einige nützliche Begriffe zur Hand (zum Beispiel Foucault, und Derrida, Horkheimer und Habermas), die harte Akademikerherzen immer erweichen" (Bradbury 1959, 422).
Für den Philosophen Paul Feyerabend (dessen Lieblingsbild ihn bei Abwaschen in der Küche zeigt) sind Fachleute Menschen voll von Vorurteilen, denen man nicht trauen könne. Einmütigkeit unter Wissenschaftlern ist oft das Ergebnis einer (wissenschafts-)politischen Entscheidung: "Abweichler werden unterdrückt, oder sie schweigen, um das Ansehen der Wissenschaften als einer Quelle vertrauenswürdiger und fast unfehlbarer Kenntnisse nicht zu kompromittieren. Dann wieder ist die Einheit des Urteils ein Ergebnis gemeinsamer Vorurteile: man macht gewisse grundlegende Annahmen, ohne sie genauer zu untersuchen, und trägt sie mit derselben Autorität vor, die sonst nur der Detailforschung zukommt. Die Wissenschaften sind voll von Annahmen oder, besser gesagt, Gerüchten dieser Art" (Feyerabend 1980, 170). Der Fachmann hat – Feyerabend weiter – oft keine Ahnung, wovon er redet: "Er hat starke Überzeugungen, er kennt einige Routine-Argumente für diese Überzeugungen, vielleicht auch Ergebnisse außerhalb seines besonderen Faches, die die Überzeugungen stützen, er stützt sich aber meistens auf Gerüchte und Tratscherei" (Feyerabend 1980, 172). [S. 23]
Wer in diesem Bereich forscht, hat sich den Leistungsstandards zu unterwerfen: an der Forschung teilhaben zu dürfen fordert ihren Preis. Die höheren Weihen der Promotion sind (zumindest im angelsächsischen Bereich) der Schlüssel zur der Welt der ernsthaften Forschung, und er wird nicht jedem gegeben. In Lightmans "Der gute Benito" hat der Physikstudent Bennet eine Aufgabe zu lösen, bevor er von seinem Professor als Doktorand akzeptiert wird. Er erfährt bei dieser Aufgabe, wie aufregend es ist (sein kann), sich nicht mehr auf andere verlassen zu müssen, sondern selbständig agieren zu können: "Jetzt hatte er eine Chance, etwas Wahres über die Welt zu entdecken, etwas absolut Wahres, ohne sich auf irgendwen verlassen zu müssen. Er schwebte in allen Wolken. Er war begeistert von seinem Problem mit den Teilchen und der Kugel, und er trug seine Seiten mit Berechnungen immer und überall bei sich, als wären es Erbschaftsdokumente" (Lightman 1996, 160).
Wissenschaft hat aber auch eine andere Seite. Ausgerichtet auf "Erfolg" und Hochleistungen, sind Wissenschaftler einem steten Konkurrenzdruck ausgesetzt. David Lodge klassifiziert sie in seinem Roman "Kleine Welt" daher als "die unzufriedensten Geschöpfe unter der Sonne. Sie meinen immer, daß auf der Nachbarweide das Gras grüner ist" (Lodge 1996, 200). Andererseits ist es aus Rücksicht auf die eigene Karriere und die Notwendigkeit, dabei auch von Konkurrenten unterstützt zu werden, angebracht, seinen Kollegen nie genug zu schmeicheln (Lodge 1996, 187). Wissenschaft betreiben und von ihr leben (können) heißt also auch, sich und anderen permanent von der eigenen Bedeutung zu überzeugen. In "Bei Tagung Mord" von D .H. J. Jones wird eine Möglichkeit, sich Aufmerksamkeit zu schaffen, beschrieben: man komme bei einer Podiumsdiskussion zunächst geräuschvoll in den Raum, drehe sich dauernd um, gebe laute Kommentare ab oder stehe auf, um den Raum wieder zu verlassen. Ein Verhalten, das allerdings die Hauptfigur des Romans (selbst Universitätsprofessorin) ihre Nachbarin fragen läßt: "Was soll das? Wurden diese Leute zu früh von der Mutterbrust entwöhnt oder was? Müssen die sich immer noch vor ihren Mamis und Papis produzieren?" (Jones 1995, 146)
Universität hat mit Menschen zu tun – auch wenn diese Menschen Professoren oder Wissenschaftler sind. Die außerwissenschaftliche Welt läßt sich nicht vollends verdrängen: da träumt ein australischer Professor davon, eine seiner Studentinnen hinter eine Düne zu zerren und ihr das Bikinihöschen herunterzureißen (Lodge 1996, 107); in Patricia Carlsons "Studie mit Mord" hortet ein Professor in seinem Büro "Raub"Kopien von Videofilmen, die er fein säuberlich in einer Bestandsliste erfaßt hat (Carlson 1996, 111-112); ein anderer verwahrt in seiner Dienst-Schreibtischlade "Mathe-Rätselhefte" (Carlson 1996, 140), und sein Kollege frönt seiner Filmleidenschaft, indem er einen aufblasbaren Weißen Hai, die Schürze, die Judy Garland im "Zauberer von Oz" und das Hemd Rudolfo Valentinos in "Der Sohn des Scheichs" (Carlson 1996, 109-110) aufbewahrt.
In ihrem Alltagsverhalten verhalten sich Wissenschaftler überaus angepaßt: sie tauschen (bezahlte) Erste-Klasse-Tickets in Tickets der Economy-Class um, um "einen kleinen Profit herauszuschlagen" (Lodge 1996, 198), und in Hotels geben sie nur selten akzeptable Trinkgelder (Jones 1995, 33). Kein Wunder, daß sie damit den Unwillen des Hotelpersonals erregen, das (so die Aussage in "Bei Tagung Mord") nur mehr den Krankenschwesternkongreß schlechter als die Arbeit für diese "großspurigen Professoren" einstuft. Außerwissenschaftliches, ernüchterndes Fazit der Empfangschefin des Hotels: sie habe "noch nie so viele dämliche Streber auf einmal" gesehen (Jones 1995, 38).
Insgesamt also ist das Bild der Professorenschaft eher ernüchternd. In Skinners "Futurum Zwei" ist der Schöpfer von "Futurum zwei" ein Universitätsabsolvent, der sich von der universitären Lehre und Forschung weg ent-[S. 24]wickelt hat. Schon in seiner Studienzeit hatte er sich sehr unkonventionell und kritisch gegenüber den universitären Institutionen verhalten: "Einmal hatte er mit einem Rotstift zu einem Zeitschriftenartikel des Rektors, den er wie einen englischen Schulaufsatz behandelte, Anmerkungen gemacht. Er hatte die Interpunktion korrigiert, die Wortstellungen verbessert und mittels Reduzierung gewisser Sätze zu logischen Symbolen eine mangelhafte Denkarbeit bloßgelegt. Dann das Ganze signiert und mit der Zensur 'mangelhaft' an den Rektor geschickt" (Skinner 1988, 22).
4. Vom wissenschaftlichen Arbeiten: "Einfach nur lesen können (...)"?
"Aber wer kennt die Tatsachen? Die Menschen glauben an eine Welt, die teils die wirkliche Welt ist und teils eine, wie sie sie gerne hätten. Keiner kennt den Unterschied. Deshalb benötigen wir die Wissenschaft (...)" (Lightman 1996, 142-143)
Wissenschaft zu betreiben heißt, sich an "Regeln" zu halten. Da ein beträchtlicher Teil der Wissenschafts-Romane von Insidern geschrieben wird, ist es nicht überraschend, daß in die Handlung immer wieder Passagen eingebaut werden, die sich mit den Voraussetzungen und den Schwierigkeiten von Wissenschaft beschäftigen. Carl Djerassis Romane lesen sich streckenweise geradezu wie Einführungen in das wissenschaftliche Arbeiten. In "Cantors Dilemma" beispielsweise lernt der Leser die Vorzüge des "Science Citation Index" schätzen, den Cantor seinem Mitarbeiter Stafford in höchsten Tönen preist: "Für dieses Werk sollten Sie dem lieben Gott auf Knien danken. Als ich in Ihrem Alter war, hatten wir nichts weiter als den Index Medicus und die Chemical Abstracts" (Djerassi 1995, 49). An einer anderen Stelle wird einer Geisteswissenschaftlerin der Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft erklärt. Er bestehe, so heißt es, vor allem auch darin, daß in den Naturwissenschaften die wissenschaftliche Arbeit in der Regel im Rahmen größerer finanziell aufwendiger Forschungsprojekte durchgeführt werde. Geisteswissenschaftler hingegen arbeiteten vorwiegend allein.
Geisteswissenschaftliche Arbeit – so der (Kurz-)Schluß aus der Sicht wohl auch des Naturwissenschaftlers Carl Djerassi – erfordert wenig Aufwand: "Alles, was Sie brauchen, ist Zugang zu einer Bibliothek (...) und Papier und Bleistift" (Djerassi 1995, 61). Bei naturwissenschaftlichen Projekten hingegen treibt der Professor die Mittel auf, er entwirft den Forschungsplan, er betreut die Projektdurchführung und ist damit auch Mitautor der schließlich veröffentlichten abschließenden Forschungsarbeit. Geisteswissenschaftler hingegen müsse man keine neuen Techniken lernen, keine neue Methodologie: "Sie müssen einfach nur lesen können. Und ein Textverarbeitungsgerät benützen können" (Djerassi 1995, 62). Daß dieses "nur" lesen können, ein wesentlicher Teil wissenschaftlicher Arbeit ist, läßt David Lodge (der selbst aus dem Bereich der Geisteswissenschaften kommt) in seinem Reise-Roman "Keine Welt" erklären: "Lesen bedeutet, sich einer nie endenden Verdrängung der Neugier und der Begierde zu überantworten – von einem Satz zum anderen, von einer Handlung zur anderen, von einer Textebene zur anderen. Der Text entschleiert sich vor [S. 25] uns, aber er läßt sich nie in Besitz nehmen, und statt danach zu streben, ihn zu besitzen, sollten wir uns der Freude an seiner Lockung hingeben" (Lodge 1996, 40).
In dieser Welt der Wissenschaft "ist man, was man schreibt", denn die Publikationen bestimmen, in welche (wissenschaftliche) "Schublade" man kommt (Jones 1995, 81-82). Diesen Ergebnissen universitären Fleißes hat Dieter Schwanitz eine besondere Passage seines Romans "Campus" gewidmet. Kernstück des Büros seines Professors (der Sozialwissenschaften) ist die Bücherwand. In ihr befindet sich der eigentliche "Hausaltar", denn: "hier standen seine Penaten und seine Privatgötter" – die von ihm verfaßten Bücher: "Hier zwischen diesen Buchdeckeln lag seine Ehre, seine Reputation und sein guter Name. Hier war das Fleisch Wort und das Wort Geist geworden. In immer neuen Kombinationen von nur 26 Buchstaben, aufgereiht in tausenden und Abertausenden von Zeilen, lag hier seine eigene persönliche Nabelschnur, die ihn mit dem Omphalos der Welt und der Doppelhelix der Urzelle verband, eine direkte Standleitung zu Elohim Adonai, dem Alpha und Omega des ewigen Alphabets. Doch wenn sein Blick liebevoll über die Buchrücken strich, fühlte er sich auch zugleich selbst als Urgrund seiner brain children, die er in männlicher Parthenogenesis gezeugt, im Leibe seines Geistes ausgetragen und aus seinem Kopf geboren hatte, er alleine ohne Mitwirkung irgendeiner Frau" (Schwanitz 1995, 56).
Zur wissenschaftlichen Forschungsarbeit gehört es allerdings – da ja die anderen auch ihre Bücherwände haben wollen – die Arbeiten anderer (Konkurrenten) kontinuierlich zu verfolgen, um zu wissen, wer an welchem Projekt gerade eben arbeitet. Dies ist nicht nur in den Naturwissenschaften wichtig. Auch in anderen Fachbereichen mag es notwendig sein, sich über die Aktivitäten der Konkurrenten zu informieren: Ein Geschichtsprofessor beispielsweise durchforstet dazu die Entlehnscheine der Seminarbibliothek, um zu entdecken, wer da noch an einem Forschungsprojekt arbeitet, das er selber für sich reservieren möchte (Schwanitz 1995, 168-170).
Wissenschaft ist ein Verteilungswettkampf um die besten Plätze in der wissenschaftlichen Wettbewerbsgesellschaft: "Veröffentlichungen, Prioritäten, die Reihenfolge der Autoren, die Wahl der Zeitschrift, die Kollegialität und der brutale Konkurrenzkampf, akademische Anstellungen, Geldbeschaffung, der Nobelpreis, Schadenfreude – sie sind die Seele und der Ballast der modernen Wissenschaft" (Djerassi 1995, 286-287). In der Welt der (Natur-)Wissenschaften ist das größte Berufsrisiko die gleichzeitige Entdeckung. Anerkennung wird nur für Originalität verliehen, was bedeutet, "daß man der erste sein muß". Die einzige Methode, sich diese Priorität zu sichern, ist, "zu fragen, wer zuerst veröffentlicht hat" (Djerassi 1995, 141-142).
In diesen leistungsorientierten Kaderschmieden wissenschaftlicher Intelligenz ist es notwendig, sich leistungsorientiert und einsatzbe[S. 26]reit zu zeigen und in Konkurrenz mit den anderen bestehen zu lernen. Das heißt auch, sich den Ritualen und Zwängen des wissenschaftlichen Alltags aus Interesse, wohl auch aus Opportunismus zu unterwerfen. Carl Djerassi hat in "Cantors Dilemma" dafür das Wort "seminieren" (so die deutsche Übersetzung) geprägt: obwohl dies ein Wort ist, das offiziell noch nicht transitiv verwendet wird, entspricht es durchaus der Realität naturwissenschaftlicher Ausbildungspraxis: "dennoch haben sich die meisten Studenten an großen forschungsorientierten Universitäten gelegentlich eher als hilflose Opfer denn als aktive Teilnehmer eines Seminars gefühlt. 'Zu Tode seminiert' beschreibt dieses Gefühl der Übersättigung" (Djerassi 1995, 155).
5. Wissenschaft als Lebenswelt: "Ist das nicht ein merkwürdiges System?"
"Jedenfalls (...) frage ich mich ab und zu, was ich sonst machen könnte, wenn ich keine Stelle an der Uni kriege. Vielleicht geh' ich zum Zirkus. Einem anderen Zirkus (...)" (Jones 1995, 59)
David Lodge beschreibt in seinem Roman "Saubere Arbeit" am Beispiel der Begegnung eines Wirtschaftsmanagers und einer Wissenschaftlerin die Mißverständnisse und die Vorurteile ihrer Lebenswelten. Das hier beschriebene "Schattenprojekt" ist der Versuch, die beiden einander fremden Welten der Universität und der Wirtschaft einander näher zu bringen. Die Literaturwissenschaftlerin muß dazu den Zauberkreis ihrer kleinen, engen universitären, wissenschaftlichen Welt verlassen. Das nun beginnende Doppelleben bereichert ihre Persönlichkeit und macht sie selbst vielschichtiger, weil sie eine bislang im Schatten ihrer eigenen Wahrnehmung liegende Welt entdeckt, die jenen unbekannt bleibt, die sich "im Lichte der universitären Bildung und Gelehrsamkeit" unbekümmert sonnten (Lodge 1992, 229). Aber auch der aus dem Fabriksalltag und der Welt des Geschäfts kommende Manager erlebt die Universität in der Person der in seinen Lebensbereich eindringenden Wissenschaftlerin zunächst als fremd und bedrohlich. Auch für ihn stand die Hochschule "im Schatten: fremd, undurchschaubar, vage, bedrohlich" (LODGE 1992, 229).
Auch in dieser professoralen Welt der Institute haben die kleinen/großen Eitelkeiten ihren Platz: Professor Hackmann in dem Roman von Dieter Schwanitz "Campus" bestand beispielsweise bei seinen Berufungsverhandlungen darauf, daß die Räume des Instituts vom übrigen Institutsbereich durch eine Glastür abgetrennt und "sein" Revier deutlich durch eine Tafel mit Namen, Funktionsbezeichnungen und akademischen Graden gekennzeichnet wurden (Schwanitz 1995, 54). Der Alltag dieses Professors ist mit universitärem Alltagskram und sehr konkreten außerwissenschaftlichen Vorsichten und Rücksichten gefüllt, und vieles kann er nur mit Hilfe seiner Sekretärin bewältigen, die die vorbereitenden Arbeiten erledigt: eine Einladung zum Rotary Club wird zunächst vorschnell abgelehnt, dann aber, nachdem die Institutssekretärin aufmerksam macht, daß der Chef eines Computerkonzerns Mitglied sei, der dem Institut einen Computer gestiftet hatte, schnell angenommen; da sagt eine Bank zu, ein wissenschaftliches Projekt zu finanzieren ("Hallelujah"); da geht es um eine Einladung der katholischen Bischofskonferenz, ein Seminar zum Thema "Religion in der modernen Gesellschaft" abzuhalten – eine Einladung, die durch den Hinweis der Sekretärin, dort habe man sicher einen guten Wein, nicht unwesentlich unterstützt wird; da findet sich schließlich auch die Mitteilung, Vorschläge für Besetzung der Berufungskommission für eine freigegebene Professorenstelle zu machen (Schwanitz 1995, 58-59).
Leben im Bereich der Wissenschaft ist wesentlich auch durch außerwissenschaftliche Bedingungen bestimmt. Wissenschaftliche Karrieren verdanken sich nicht immer nur der [S. 27] wissenschaftlichen Qualität des "Aufsteigers". Notwendig und förderlich ist da auch die Zuarbeit anderer, die wiederum selbst darauf hoffen, auf der Karriereleiter hinaufklettern zu können und dann – ganz oben – die Arbeit ihrer wissenschaftlichen "Hilfs"-Kräfte für sich nutzen zu können. In Malcolm Bradburys "Doctor Criminale" findet sich dazu folgender Dialog zwischen dem Erzähler und einem Universitätsassistenten der Wiener Universität: "'Ist das nicht ein merkwürdiges System?' fragte ich. 'Sie machen die Arbeit, und er heimst allen Ruhm ein?' 'Nein, nein', sagte Gerstenbäcker. 'Eines Tages werde ich selbst einen Ruf bekommen und ein bedeutender Professor werden. Dann habe ich viele Assistenten, und sie schreiben meine Bücher für mich.' 'Aha, so erhält letztendlich doch alles seinen Sinn', sagte ich (...)" (Bradbury 1995, 99).
Abhängigkeiten und Interessen bestimmen den universitären Alltag. Für Außenstehende mag dies zunächst noch nicht erkennbar sein. Alice Hopfmiller in Dieter Schwanitz' "Campus" ist zunächst über die angenehme Atmosphäre im Historischen Seminar überrascht:
"Wie bei jedem Neuen, der noch nicht durch Bündnisse und Seilschaften vereinnahmt war, witterten alle Angehörigen des Instituts die Chance, die Macht ihres Bündnisses durch ein weiteres Mitglied zu vergrößern (...) Man erklärte ihr geduldig die Stammessitten, zeigte ihr die akademischen Futterstellen und Tränkplätze in der Umgebung des Campus, erzählte ihr die Lokalmythen und weihte sie in die Mysterien der Stammesreligion der Hamburger Historiker ein" (Schwanitz 1995, 165). Alice ist sich bewußt, daß das nur so lange dauern werde, als sie sich nicht einen der Cliquen angeschlossen oder als bündnisunfähige Einzelgängerin entpuppt hatte. Sie beschließt jedenfalls diese Phase der interessenorientierten allgemeinen Zuwendung so lange wie möglich andauern zu lassen: "Wie die große Elisabeth von England wollte sie ihre Jungfräulichkeit teuer verkaufen und am Ende womöglich behalten. Und so begriff sie, daß die Freundlichkeit, mit der die alteingesessenen Mitglieder des Instituts eine Neue wie sie behandelten, im direkten Verhältnis zu der Intensität stand, mit der sie sich gegenseitig haßten" (Schwanitz 1995, 165).
Wissenschaftler gehen ihren Lebensweg in der Regel nicht allein. Sind es Professoren, so sind es "ihre" Frauen, die sie im Hintergrund begleiten und – meist unbedankt – die Rahmenbedingungen für erfolgreiches professoral-wissenschaftliches Leben schaffen. Professor Swallow aus David Lodges "Kleine Welt" beispielsweise reagiert äußerst rüde, als ihn seine Frau die notwendige Unterstützung beim Kofferpacken kurz vor der Abreise zu einer Tagung verweigert. Als sie ihn bei seiner Suche nach frischen Socken und Unterwäsche daran erinnert, daß er sich dies hätte früher überlegen sollen, reagiert der Professor bitter – sie hätte sich doch denken können, daß er ein paar saubere Sachen mitnehmen möchte. Als ihn seine Frau darauf hinweist, daß auch er an ihre Bedürfnisse denken könnte, repliziert der Professor, der seine wissenschaftlichen Interessen großteils nur auf ihre Kosten ausleben kann, lediglich: "'Was für Bedürfnisse?' 'Das ich so was überhaupt habe, übersteigt wohl dein Vorstellungsvermögen', sagte Hilary. 'Mir liegt nichts an abgehobener Argumentation, sagte Philip resigniert, 'ich hätte nur gern ein paar saubere Socken und Unterhosen und Unterhemden, falls das nicht zuviel verlangt ist'" (Lodge 1996, 202).
6. Wenn Wissenschafter reisen: "Um dort zu tagen und zu bechern"
"Die moderne Tagung ähnelt der Pilgerfahrt des christlichen Mittelalters insofern, als sie den Teilnehmern Gelegenheit bietet, alle Freuden und Zerstreuungen des Reisens zu genießen, während sie allem Anschein nach strikt auf Weiterbildung erpicht sind. Gewiß, bestimmte Bußübungen sind zu absolvieren, [S. 28] so muß vielleicht ein Vortrag gehalten werden, müssen ganz gewiß Vorträge angehört werden" (Lodge 1996, 7).
Die Welt der Wissenschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten entscheidend verändert. David Lodge läßt dies in seinem Buch "Kleine Welt" einen Professor selbst sagen, der auf den Campus der Stadt, in der er zu einem Vortrag eingeladen wurde, hinabblickt und dabei das Ende der individuellen Hochschule reflektiert. Die herkömmliche Universität als "Schwerindustrie des Geistes" habe – so seine Schlußfolgerung – ausgedient. Schwer und schwerfällig ist sie an einen Ort gebunden; Wissen hingegen ist inzwischen wie die Menschen viel transportabler geworden: "Ergo braucht man Information nicht mehr in einem Gebäude zu horten oder die besten Wissenschaftler in einem Campus einzupferchen. Drei Dinge – allerdings haben das bisher nur die wenigsten kapiert – haben in den letzten zwanzig Jahren das akademische Leben revolutioniert: das Düsenflugzeug, die telefonische Direktwahl und der Fotokopierer. Wenn Wissenschaftler Anregungen austauschen wollen, brauchen sie nicht mehr im gleichen Haus zu arbeiten. Sie rufen sich an oder treffen sich bei internationalen Tagungen. Und sie brauchen, um sich Unterlagen zu beschaffen, nicht mehr in den Bibliotheken herumzuhocken. Wenn ein Buch oder ein Artikel sie interessiert, lassen sie ihn fotokopieren und lesen ihn zu Hause" (Lodge 1996, 59-60).
Wissenschaft ist zu einem großen Reiseunternehmen geworden, das seine Touristen rund um die ganze Welt schickt, um mit anderen Wissenschaftsreisenden das Angenehme eines Lebens als Wissenschaftler mit dem Nützlichen eines Touristen zu verbinden, der es sich gutgehen lassen möchte. Allerdings wird schon die Ankunft entillusioniert: "Wenn Leute von weither zu einem Kongreß angereist sind und sich am Eröffnungsabend an herrlichen Speisen und Weinen erfreut haben, lassen sie sich gern von ihren eigenen Anstrengungen erzählen und zu adelnder Arbeit anspornen, auch wenn sie genau wissen, daß das wenig mit der Realität der nachfolgenden Tage zu tun hat" (Bradbury 1995, 191). Auf solchen Kongressen entwickelt sich eine typische Kongreßatmospähre: jenes merkwürdige Gefühl, daß keine andere Welt existiert, daß die einzige menschliche Realität ist, daß all die Probleme, die wir zurückgelassen haben, ohne hin keine Probleme gewesen sind, und daß jede Annehmlichkeit, jede Freude uns zusteht. Dann formen sich allmählich Konferenzpersönlichkeiten heraus, Konferenzfreundschaften – auch mehr als Freundschaften – entwickeln sich, Konferenzfeindschaften entstehen" (Bradbury 1995, 204).
David Lodge hat in einer "akademischen Romanze" (so der Untertitel seines Buches "Kleine Welt") den wissenschaftlichen Mikrokosmos "Tagung" ausführlich beschrieben. Tagungen – das sind die "Wallfahrten" von gestern, freilich mit einigen Unterschieden: "Die moderne Tagung ähnelt der Pilgerfahrt des christlichen Mittelalters insofern, als sie den Teilnehmern Gelegenheit bietet, alle Freuden und Zerstreuungen des Reisens zu genießen, während sie allem Anschein nach strikt auf Weiterbildung erpicht sind. Gewiß, bestimmte Bußübungen sind zu absolvieren, so muß vielleicht ein Vortrag gehalten werden, müssen ganz gewiß Vorträge angehört werden. Doch unter diesem Vorwand reist du zu neuen und interessanten Orten, lernst neue und interessante Leute kennen, knüpfst neue und interessante Kontakte, tauschst Klatsch und Vertraulichkeiten aus (denn deine abgegriffenen Histörchen sind für die anderen Tagungsteilnehmer neu und reizvoll und vice versa), ißt, trinkst und vergnügst dich Abend für Abend in ihrer Gesellschaft – und gerätst trotzdem, wenn alles vorbei ist und du wieder zu Hause bist, in den Geruch, ein ganz besonders seriöser Zeitgenosse zu sein. Die Konferenzler von heute sind in der Beziehung besser dran als die Pilger von früher, weil sie ihre Spesen meist von der Institution, der sie angehören – sei es [S. 29] nun eine Regierungsstelle, eine Firma oder (wohl der häufigste Fall) eine Hochschule –, bezahlt oder zumindest bezuschußt werden" (Lodge 1996, 7).
Diese Stätten der Gelehrsamkeit, zu denen Wissenschaftler aus aller Welt eilen, um dort "zu tagen und zu bechern", auf daß ihre akademischen Fächer nicht untergehen (Lodge 1996, 8), sind für David Lodge Anlaß zu einer amüsanten, stellenweise vielleicht überzeichneten, manchmal freilich überraschend präzisen Darstellung von Wissenschaft. Hier bestimmen Hierarchien und persönliche Eitelkeiten, Karrierestreben und Opportunismus; hier ist auch von Wissenschaft, aber nicht nur von ihr die Rede; hier schaffen sich Kapazitäten ein Forum der Selbstdarstellung oder werden zur Hebung der Reputation der Einladenden benutzt: "Die großen Tiere hauen meist ab, sobald sie ihr Sprüchlein aufgesagt haben. Man kommt sich vor wie in einer belagerten Armee, wenn der General sich im Hubschrauber ausfliegen läßt" (Lodge 1996, 26).
Die sonst sorgsam aufrechterhaltene Trennung zwischen Wissenschaft und "Leben" ist eine Konstruktion, die allerdings zum oft geglaubten und immer wieder reproduzierten Klischee geworden ist. Tagungen sind für David Lodge geradezu ein exemplarisches Beispiel dafür, wie nahtlos beide Bereiche ineinander überzugehen imstande sind: "Die Seele wird im Vortragsraum und im Seminarraum erfreut, der Leib in Restaurants und Nachtklubs. Dabei muß kein Interessenkonflikt entstehen. Fachsimpeln kann man trotzdem – über Phonetik oder Dekonstruktion oder Hirtenelegien oder Akzentverschiebung – beim Essen, Trinken, Tanzen, ja sogar beim Schwimmen. Wissenschaftler bringen unter der Schockwirkung dieser Entdeckung die erstaunlichsten Dinge fertig, Dinge, die der daheimgebliebene Partner, die daheimgebliebenen Kollegen nie für möglich halten würden. Sie durchtwisten die Nacht in der Disco, singen sich im Bierkeller heiser, nehmen hüllenlos ein mitternächtliches Bad, gehen auf den Rummelplatz und fahren auf der Achterbahn" (Lodge 1996, 289). Aus dem elfenbeinernen Turm ihrer Wissenschaft entlassen, entdecken die Wissenschafts-Touristen ein "Leben", das ihnen bisher entgangen zu sein schien: "Sie holen sich die Jugend zurück, die sie, wie sie meinen, der Wissenschaft geopfert haben, sie beweisen sich, daß sie doch keine staubtrockenen Streber sind, sondern lebende, atmende, zuckende Menschenwesen mit warmem Fleisch und Blut" (Lodge 1996, 289). Nicht alle freilich lassen sich täuschen. Die Frau eines bedeutenden Literaten, der von Tagung zu Tagung eilt, lehnt es respektlos ab, mit nach Heidelberg zu einer Tagung über die Rezeption literarischer Texte zu fahren, da sie es satt hat, "in Kirchen und Museen rumzulatschen", während ihr berühmter Gatte mit den Honoratioren "labert" (Lodge 1996, 136).
7. Popularisierung von Wissen: "Das Geheimnis des Schlosses von Monte Carlo"
"(...) Nur wenige Professoren sind fähig, das, was sie denken und fühlen, in verständliche und wohlgesetzte Worte zu kleiden. Zu fürchten haben sie dennoch nichts, es sei denn, ihre begabten Schüler, die ihnen nacheifern und sie bald einmal überrunden könnten. Doch da sorgt schon ein kritischer Nebensatz in einem Gutachten dafür, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. So entdecken Professoren mit der Zeit ihre absolute Unvergleichbarkeit – und von diesem Augenblick an sind sie konkurrenzlos insular (...)" (Camartin 1994, 234-235).
Wie Vermittlung von Wissen funktionieren kann, hat Raymond Smullyan in seinem mathematischen Rätselbuch "Dame oder Tiger" beschrieben. Sein Ziel war es, Aufgaben zu präsentieren, die einen bedeutsamen Bezug zu profunden und wichtigen Ergebnissen der Lo[S. 30]gik und Mathematik erhalten. Seine mathematischen Lösungsaufgaben sind als Erzählungen ("mathematische Novellen") konzipiert, in denen das Problem in eine spannende Kurzgeschichte verpackt ist. Für den zweiten Teil seines Buches hält Smullyan daher auch den Titel "Das Geheimnis des Schlosses von Monte Carlo" für durchaus denkbar, da es von einem "Fall handelt, in dem Inspektor Craig von Scotland Yard eine Zahlenkombination herausfinden muß, um das Schloß eines Safes in Monte Carlo zu öffnen, damit ein Unglück verhindert wird". In Zusammenarbeit mit einem Erfinder von Zahlenmaschinen und einem Spezialisten für mathematische Logik denken sich die drei dann in zunehmend tiefere Regionen vor, die zum Kern von Gödels großartiger Entdeckung führen: "Natürlich entpuppt sich das Kombinationsschloß von Monte Carlo als ein verborgenes 'Gödelsches Schloß', sein modus operandi spiegelt auf wunderbare Weise einen Grundgedanken Gödels wider, der grundlegend in viele wissenschaftliche Theorien hineinreicht, die mit dem bemerkenswerten Phänomen der Selbstreproduktion zu tun haben" (Smullyan 1986, 10).
Interessant und lesenswert sind die Texte jedenfalls auch deswegen, weil immer wieder sehr konkrete, ernsthafte Überlegungen zu Grundprinzipien wissenschaftlichen Denkens und Handelns, überraschend oft auch akademische Lesefrüchte und theoretische Überlegungen, manchmal auch konkrete wissenschaftliche Fallbeispiele eingebracht werden. Alexis Lecaye läßt die Lösung eines Mordfalls in seinem Roman "Einstein und Sherlock Holmes" mit Hilfe der Interpretation des 1. Hauptsatzes der Thermodynamik geschehen. Albert Einstein gibt in einem Gespräch mit Sherlock Holmes dazu die wissenschaftliche Erklärung: "Das ist eine der geläufigsten Arten, in der Chemie die Gültigkeit des Ersten Hauptsatzes der Thermodynamik zu überprüfen, der lautet: 'Welche Veränderungen auch immer im Inneren eines geschlossenen Systems vor sich gehen, die Summe aller Energiearten in diesem System bleibt konstant. Man kann das auch anders ausdrücken: Wenn Sie auf einer Schiffsbrücke stehen und auf das Segel blasen, wird das Schiff nicht schneller. Dahinter steckt das gleiche. Es ist das bekannte Prinzip von der Erhaltung der Energie'" (Lecaye 1990, 128).
Keith Oatleys (erfundene) psychoanalytische Fallgeschichte der Emily V. enthält einen (fiktiven) Vortag Sigmund Freuds, gehalten vor der Psychologischen Mittwoch-Gesellschaft, in der er sich mit einem Fall von weiblicher "Hysterie" beschäftigt. In dem ebenfalls erfundenen Nachwort nimmt eine Psychonanalytikerin dazu Stellung. Gleichzeitig dient dieses Nachwort dazu, auf die Quellen, die der [S. 31] Autor für sein Buch nutzte, aufmerksam zu machen, wobei es im speziellen um die (kriminalistische) Methode Freuds geht. Gleichzeitig geht es auch um eine Kritik an der Methode Freuds, der mit "seiner" Psychoanalyse lediglich die "innere" Welt zu erfassen imstande ist, dabei aber die "äußere" Welt, das heißt: die konkreten Umstände des geschilderten Lebens, nicht – oder besser: nur in Ansätzen – zu erreichen vermag.
Der Neurophysiologe William H. Calvin hat in einem Reiseroman versucht, die Entstehung des Menschen und des menschlichen Bewußtseins/Geistes darzustellen und damit versucht, an alte Vorbilder anzuknüpfen: "Seit Homer haben Schriftsteller jedoch immer wieder festgestellt, daß die Schilderung einer Reise geeignet ist, den Leser mitzureißen, und seit Galilei ist Wissenschaftlern bekannt, daß man neue Ideen durch Unterhaltungen zwischen imaginären Personen vermitteln kann" (Calvin 1994, 12). Auf einer Schlauchbootfahrt den Colorado River abwärts finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Expedition reiche Gelegenheit, ihr Wissen über Anthropologie, Neurobiologie und Evolutionsbiologie auszutauschen. Den Grand Canyon hat Calvin deshalb für seine Reise gewählt, weil die Geschichte der Evolution in "angemessener Umgebung" erzählt werden sollte – vor dem großartigsten Schaubild, das die Erde von der Evolution liefert: "Seine Gesteinsschichten reichen bis in die Zeit zurück, als Bakterien das Leben auf der Erde beherrschten; seine Fossilien bezeugen die postpräkambrische Explosion von Lebensformen von zunehmender Komplexität; seine Ruinen enthüllen die Menschheitsgeschichte der Steinzeit. Und die unverstellte Natur, die wir dort antreffen, zeigt uns jene noch von keiner Zivilisation berührten Umstände, für die uns die Evolution geformt hat; sie läßt uns jene Anfänge erahnen, die wir uns kaum vorzustellen oder in Worte zu fassen vermögen" (Calvin 1994, 12).
Angeregt durch ihre Fahrt durch die Evolution, arbeiten sich Expeditionsteilnehmer von Problem zu Problem durch: ausgehend von der Besessenheit der Politiker, Staudämme zu bauen, geht es beispielsweise dann um die Problematik moderner Bewässerungsmethoden, und wir erfahren bei dieser Gelegenheit zusätzlich auch, wie das Gehirn den Salzgehalt des Blutes reguliert und was passiert, wenn das antidiuretische Hormon (ADH) durch zuviel Bierkonsum auf seinem Weg zu den Nieren blockiert wird und dadurch die Wasserabgabe unkontrolliert ausgelöst wird – die dadurch resultierende Austrocknung des Körpers ist die Ursache eines Katers (Calvin 1994, 108-114). Die sprachliche Entgleisung einer Teilnehmerin, die sich plötzlich dem Wasserschwall einer Stromschnelle ausgesetzt sieht, ist der Anlaß dafür, über das Sprachzentrum der linken Hirnhälfte und die Entstehung beziehungsweise den Erwerb der menschlichen Sprache zu reflektieren (Calvin 1994, 465-467). Bei den Deer-Creek-Wasserfällen ist der Weg vom Menschenaffen zu Lucy das Thema, und es erhebt sich die Frage, "Was in aller Welt mag zur Auslese der Unbehaartheit geführt haben?" (Calvin 1994, 379).
Einen anderen Weg ist Alan Lightman gegangen. Er hat in seinem Roman "Und immer wieder Zeit" versucht, anhand vieler kleiner Geschichten die möglichen Konsequenzen der Relativitätstheorie Albert Einsteins darzustellen. Dazu läßt Albert Einstein die Konsequenzen seiner Theorie erträumen: "In dem langen, schmalen Amtszimmer in der Seichergasse, dem Raum voller praktischer Ideen, räkelt sich noch immer der junge Patentbeamte auf seinem Stuhl, den Kopf auf der Schreibtischplatte. In den letzten Monaten, seit Mitte April, hat er viele Träume über die Zeit geträumt. Seine Träume haben sich auf seine Forschungen ausgewirkt. Seine Träume haben ihn mitgenommen, haben ihn dermaßen erschöpft, daß er manchmal nicht weiß, ob er wacht oder schläft. Doch mit den Träumen ist es vorbei. Von den vielen möglichen Visionen der Zeit, erträumt in ebenso vielen Nächten, scheint ihm eine zwingend zu sein" (Lightman 1995, 10-11). [S. 32]
8. Ein anderes Leben, eine andere Wissenschaft: "Nicht irgendwo in einem Elfenbeinturm sitzen"
"Man muß das Experiment selber machen, und zwar als Experiment mit dem eigenen Leben!" (SKINNER 1988, 21)
Die wissenschaftliche Societät, die hier und in anderen Texten gezeichnet wird, ist gewiß überzeichnet, in manchem freilich auch überaus scharf getroffen. Alles in allem werden in den Texten immer wieder Denkschneisen gelegt, die es wert sind, im Nachdenken weiter ausgebaut zu werden. Die Texte sind oft skurril, vielfach geradezu unglaublich, jedenfalls aber oft befremdend-belustigend: Wissenschaft ereignet sich offenkundig – auch – ganz anders, als dies im allgemeinen Bewußtsein zu sein scheint. Kritische Distanz ist hier sicher nötig. Nicht alles ist im Maßstab eins zu eins zu übernehmen. Vieles ist "erfunden", manches aber sollte zum Denken/Nachdenken Anlaß geben.
Wissenschaft mag sich schon so ereignen, wie es sich der Kleine Maxi nicht vorstellt. Freilich gibt es auch die Vision einer "anderen" Wissenschaft, die sich aus der oft "beschränkten" Welt der Wissenschaft hinaus wagt in das Leben, die Eitelkeiten und Rangpositionen hinter sich läßt und sich damit auch persönliche Freiräume schafft. Dieter Schwanitz erzählt in seinem Universitätsroman "Campus" die Geschichte eines renommierten deutschen Soziologieprofessors, der sich schließlich von der Universität abwendet und zu einer neuen Existenz findet: "Echter. Authentischer. Er genießt es, ein wissenschaftlicher Robin Hood zu sein. Er hat die Rolle seines Lebens gefunden. Diogenes in der Tonne. Er ist ein gepflegter Outcast, ein Sinnlieferant der Protestkultur, nicht des Establishments" (Schwanitz 1995, 382). Auch in Skinners "Futurum zwei" geht es darum, Wissenschaft mit dem Leben zu verbinden: "man muß das Experiment selber machen, und zwar als Experiment mit dem eigenen Leben! Und man darf nicht irgendwo in einem Elfenbeinturm sitzen und zugucken, als ob das eigene Leben nicht darin verwickelt wäre" (Skinner 1988, 21).
Ich komme damit zum Anfang zurück: Nachdem er die Möglichkeiten der Neuen Erziehung kennengelernt hatte, beschließt der Erzähler von "Futurum Zwei", sein bisheriges, "normales" Leben an der Universität aufzugeben und dies auch seinem Rektor per Telegramm mitzuteilen: "(...) unter Außerachtlassung des üblichen Telegrammstils und meine euphorische Ausgelassenheit mühsam beherrschend, malte ich langsam und pedantisch diese Worte: Lieber Rektor Mittelbach stop Sie können sich ihre blöde Universität (...) Das hübsche Fräulein hinter den Schalter überlas die Nachricht von vorn bis hinten mit beruflicher Routine. Dann ließ sie sich mit angenehmer, aber routinierter Amtsstimme vernehmen: 'Es tut mir leid, mein Herr, aber diese Art Text können wir nicht weitergeben.'" (Skinner 1988, 280-281). [S. 33]
Literaturverzeichnis:
Im angelsächsischen Bereich hat der Universitätsroman eine lange Tradition. Ein Überblick über Umfang und Inhalt dieser Literaturgattung ist zu finden bei: Wolfgang Weiss, Der angloamerikanische Universitätsroman. Eine historische Skizze. 2. Aufl. Darmstadt 1994, und Ulrike Dubber, Der englische Universitätsroman der Nachkriegszeit. Ein Beitrag zur Gattungsbestimmung. Würzburg 1991 (Kieler Beiträge zur Anglistik und Amerikanistik. NF. 1). Hier finden sich auch umfangreiche Literaturhinweise, die zur Ergänzung der folgenden Literaturliste nützlich sein könnten.
Malcolm Bradbury, Doctor Criminale, München 1995.
Malcom Bradbury, Der Geschichtsmensch, Stuttgart 1989.
William H. Calvin, Der Strom, der bergauf fließt. Eine Reise durch die Evolution. München-Wien 1994.
Iso Camartin, Die Bibliothek von Pila, Frankfurt am Main 1994.
Patricia M. Carlson, Studie mit Mord. Berlin-Hamburg, 1996.
Amanda Cross, Eine feine Gesellschaft, 3. Aufl., München 1994.
Carl Djerassi, Das Bourbaki-Gambit, München 1995.
Carl Djerassi, Cantors Dilemma. Roman. 3. Aufl., München 1995.
Carl Djerassi, Die Mutter der Pille, München 1996.
Thea Dorn, Berliner Aufklärung, 2. Aufl., Berlin 1994.
Paul Feyerabend, Erkenntnis für freie Menschen. Veränderte Ausgabe, Frankfurt am Main 1980.
Elizabeth George, Denn bitter ist der Tod, München 1995.
Frigga Haug, Jedem nach seiner Leistung, Hamburg 1995.
Hans-Jürgen Heinrichs, Erzählte Welt. Lesarten der Wirklichkeit in Geschichte, Kunst und Wissenschaft. Reinbek bei Hamburg 1996.
D. H. J. Jones, Bei Tagung Mord. Hamburg 1995.
Philipp Kerr, Das Wittgenstein-Programm. Reinbek bei Hamburg 1995.
Alexis Lecaye, Einstein und Sherlock Holmes, Frankfurt am Main 1990.
Alan Lightman, Der gute Benito, Hamburg 1996.
Alan Lightman, Und immer wieder die Zeit. Einstein's Dreams, München 1995.
David Lodge, Kleine Welt. Eine akademische Romanze, Zürich 1996.
David Lodge, Saubere Arbeit, 3. Aufl., München 1992.
Charlotte MacLeod, "Stille Teiche gründen tief", Köln 1994.
Jürgen Mittelstraß, Wissenschaft als Lebensform. Reden über philosophische Orientierungen in Wissenschaft und Universität. Frankfurt am Main 1982.
Vladimir Nabokov, Pnin,. Reinbek bei Hamburg 1995.
Robert Robinson, Die toten Professoren, 2. Aufl., Köln 1994.
Horst Rumpf, Schule gesucht. Tagebuch eines Studienrates (2) (...) aus einer erfundenen Schule, Braunschweig 1968.
Dieter Schwanitz, Der Campus. Frankfurt am Main, 1995.
B. F. Skinner, Futurum Zwei. "Walden Two". Die Vision einer aggressionsfreien Gesellschaft, Reinbek bei Hamburg 1988.
Jane Smiley, Moo, Frankfurt am Main 1995.
Raymond Smullyan, Dame oder Tiger? Logische Denkspiele und eine mathematische Novelle über Gödels große Entdeckung, Frankfurt am Main 1985.
Donna Tartt, Die Geheime Geschichte, München 1993.
Barbara Wood, Der Fluch der Schriftrollen, Gütersloh 1994.
(Wortwahl, Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung entsprechen dem Original. Die im Original durch Sperrung hervorgehobenen Wörter wurden kursiv gesetzt. In eckiger Klammer steht die Zahl der jeweiligen Seite des Originaltextes. Offensichtliche Druckfehler wurden berichtigt.)