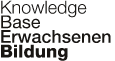Populärwissenschaft im Banne elitärer Ideologien im ausgehenden 19. Jahrhundert
Titelvollanzeige
| Autor/in: | Szanya, Anton |
|---|---|
| Titel: | Populärwissenschaft im Banne elitärer Ideologien im ausgehenden 19. Jahrhundert |
| Jahr: | 1998 |
| Quelle: | Spurensuche. Zeitschrift für Geschichte der Erwachsenenbildung und Wissenschaftspopularisierung, 9. Jg., 1998, H. 1/2, S. 29-57. |
Über den Geist des „fin de siècle“
Das ausklingende 19. Jahrhundert war eine bewegte, von zahlreichen Widersprüchen gekennzeichnete und zerrissene Zeit. „Niemand wußte genau, was im Werden war“, beschrieb der österreichische Dichter Robert Musil (1880-1942) rückblickend diese so chamäleonhafte Epoche, „niemand vermochte zu sagen, ob es eine neue Kunst, ein neuer Mensch, eine neue Moral oder vielleicht eine Umschichtung der Gesellschaft sein solle. Darum sagte jeder davon, was ihm paßte. Aber überall standen Menschen auf, um gegen das Alte zu kämpfen. Allenthalben war plötzlich der rechte Mann zur Stelle; und was so wichtig ist, Männer mit praktischer Unternehmungslust fanden sich mit den geistig Unternehmungslustigen zusammen. Es entwickelten sich Begabungen, die früher erstickt worden waren oder am öffentlichen Leben gar nicht teilgenommen hatten. Sie waren so verschieden wie nur möglich, und die Gegensätze ihrer Ziele waren unübertrefflich. Es wurde der Übermensch geliebt, und es wurde der Untermensch geliebt; es wurden die Gesundheit und die Sonne angebetet, und es wurde die Zärtlichkeit brustkranker Mädchen angebetet; man begeisterte sich für das Heldenglaubensbekenntnis und für das soziale Allemannsglaubensbekenntnis; man war gläubig und skeptisch, naturalistisch und preziös, robust und morbid; man träumte von alten Schloßalleen, herbstlichen Gärten, gläsernen Weihern, Edelsteinen, Haschisch, Krankheit, Dämonen, aber auch von Prärien, gewaltigen Horizonten, von Schmiede- und Walzwerken, nackten Kämpfern, Aufständen der Arbeitssklaven, menschlichen Urpaaren und Zertrümmerung der Gesellschaft. Dies waren freilich Widersprüche und höchst verschiedene Schlachtrufe, aber sie hatten einen gemeinsamen Atem; würde man jene Zeit zerlegt haben, so würde ein Unsinn herausgekommen sein wie ein eckiger Kreis, der aus hölzernem Eisen bestehen will, aber in Wirklichkeit war alles zu einem schimmernden Sinn verschmolzen. Diese Illusion, die ihre Verkörperung in dem magischen Datum der Jahrhundertwende fand, war so stark, daß sich die einen begeistert auf das neue, noch unbenützte Jahrhundert stürzten, indes die anderen sich noch schnell im alten wie in einem Hause gehen ließen, aus dem man ohnehin auszieht, ohne daß sie diese beiden Verhaltensweisen als sehr unterschiedlich gefühlt hätten.“1
Diese Widersprüchlichkeit kann als Ausdruck einer tiefgehenden und verbreiteten Verunsicherung in Bezug auf die Fragen nach dem Sinn und Zweck des menschlichen Daseins gedeutet werden. Vor allem in der zweiten [S. 29] Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dem „allgemeinen Narzißmus, der Eigenliebe der Menschheit", wie Sigmund Freud (1856-1939) im Jahre 1917 sagte, die schwere „biologische Kränkung" zugefügt. „Wir wissen es alle“, schrieb er, „daß die Forschung Ch. Darwins, seiner Mitarbeiter und Vorgänger vor wenig mehr als einem halben Jahrhundert dieser Überhebung des Menschen ein Ende bereitet hat. Der Mensch ist nichts anderes und nichts Besseres als die Tiere, er ist selbst aus dem Tierreiche hervorgegangen, einigen Arten näher, anderen ferner verwandt. Seine späteren Erwerbungen vermochten es nicht, die Zeugnisse der Gleichwertigkeit zu verwischen, die in seinem Körperbau wie in seinen seelischen Anlagen gegeben sind. Das ist aber die zweite, die biologische Kränkung des menschlichen Narzißmus.“2
Je weiter das 19. Jahrhundert fortschritt, um so unwiderleglicher wurden die Beweise der wissenschaftlichen Forschung, daß der Mensch nicht von Gott geschaffen und als Herr über die Erde und ihre Lebewesen eingesetzt worden war, wie dies Judentum und in seinem Gefolge Christentum und Islam als einen wesentlichen Bestandteil ihrer Lehren behaupteten, sondern daß er in einem vielfältigen organischen Zusammenhang mit ihr verbunden sei. Den ersten dieser Beweise lieferte Johann Carl Fuhlrott (1804-1877), als er im Jahre 1856 im Neandertal3 zwischen Düsseldorf und Wuppertal das Bruchstück eines Schädeldaches fand, das zwar menschliche Merkmale aufwies, sich aber deutlich vom Schädel eines gegenwärtigen Menschen unterschied. Damit war der als Neandertaler bekannte frühe Ahne des Menschen entdeckt.4 Drei Jahre später, im Jahr 1859, veröffentliche Charles Darwin sein grundlegendes Werk „Die Entstehung der Arten durch natürliche Auslese oder die Erhaltung der bevorzugten Rassen im Ringen ums Dasein", mit dem er, aufbauend auf das auf einer mehrjährigen Weltreise in den dreißiger Jahren gesammelte Material, die sogenannte „Selektionstheorie“ als wichtigen Baustein der Evolutionstheorie der Theorie von der ständigen Weiter- und Höherentwicklung des Lebens, begründete.5
Während Darwin es in seiner „Entstehung der Arten“ noch vermied, seine Selektionstheorie auch unmittelbar auf den Menschen anzuwenden, waren andere Forscher nicht so zauderlich. Ernst Haeckel (1834-1919) stellte bereits im Jahre 1863 auf einer Versammlung von Naturforschern und Ärzten in Stettin fest, daß die nächsten Anverwandten des Menschen in „affenähnlichen Säugetieren" des Tertiärs6 zu suchen und zu finden seien. Im Jahr darauf veröffentliche Thomas Huxley (1825-1895), ein enger Forscherkollege Darwins, seine Arbeit „Zeugnisse für die Stellung des Menschen in der Natur". Charles Darwin selbst brachte erst im Jahre 1871 sein zweites großes Werk heraus, eine umfangreiche Untersuchung über „Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl". Seither bestanden in der wissenschaftlichen Welt keine Zweifel mehr daran, daß der Mensch nur eine der vie-[S. 30]len Lebensformen der Erde und auch seine Entwicklung, seine Evolution in die des organischen Lebens eingebettet sei. Seitdem suchten die Forscher fieberhaft nach dem „missing link“, dem fehlenden Verbindungsglied im gemeinsamen Stammbaum von Menschen und Affen. Als zwei Jahrzehnte später Eugéne Dubois im Jahre 1891 bei Trinil auf der Insel Java Skelettreste fand, ordnete er sie kühn einem „Pithecanthropus erectus", zu deutsch einem aufrechten Affenmenschen zu.
So begeisternd die in immer rascherer Folge bekannt werdenden Kenntnisse über die Entwicklung der Erde und des Lebens waren, so lösten sie doch auch einige Bangigkeit aus, machten sie doch auch den Glauben an das Eingebundensein des Menschen in einen sinnvollen Seins- und Lebenszusammenhang, wie ihn die verschiedenen Religionen lehren, immer schwerer nachvollziehbar. Zunehmend klarer und unausweichlicher wurden die weltanschaulichen Auswirkungen, welche die uneingeschränkte Anerkennung der Evolutionstheorie nach sich ziehen müßte. Einerseits würde dadurch die bisher so reinliche Scheidung zwischen Mensch und Tier zum Verschwinden gebracht und durch ein mit verschwimmenden Grenzen behaftetes Mensch-Tier-Übergangsfeld ersetzt, das der Mensch, da seine Entwicklungsgeschichte ja noch immer nicht abgeschlossen, sondern in die Zukunft hinein offen ist, möglicherweise noch gar nicht ganz durchschritten hätte. Wie sehr diese Vorstellung in den Menschen Abwehr auslöste, läßt sich daran erkennen, daß Otto Henne am Rhyn in seiner im Jahr 1886 erschienen „Kulturgeschichte des deutschen Volkes“, auf die noch die Rede kommen wird, mit Blick auf die bereits genannten Schädel von Neandertal-Menschen trotz des in seiner Zeit schon sehr überzeugenden Beweismaterials für eine weit zurückreichende Entwicklungsgeschichte des Menschen, doch mehr dazu hinneigte, „in denselben krankhafte Mißbildungen zu finden“7. Noch in der Gegenwart verwahren sich Menschen dagegen, zu nahe neben das Tier gestellt zu werden, wie der Leserbrief eines gewissen Hans Bayer aus Hamburg an die populärwissenschaftliche Zeitschrift „Das Tier“ zeigt, wo er schreibt: „Auch wenn die Wissenschaft 1000mal das Gegenteil behauptet: Der Mensch ist kein Affe. Die Gleichmacherei von Affe und Mensch, die in der jüngsten Vergangenheit zur Mode geworden ist, ist falsch. Der Mensch ist ein geistiges Wesen und der Schimpanse nicht.“8
Andererseits würde, da der Mensch wie auch alles übrige Leben auf der Erde lediglich das Ergebnis des Wechselspiels von zufälliger Mutation beziehungsweise zufälliger Änderung der Umweltbedingungen und von der notwendigen Anpassung an diese, um den Fortbestand des Lebens zu sichern, wäre, das Dasein des Menschen und darüber hinaus auch seine Geschichte und in letzter Konsequenz die gesamt Welt jeder Sinngebung verlustig gehen. Es ist genau das, vor dessen Anerkennung der Mensch zurückschreckt. Aus in den Tiefen seiner Seele wurzelnden Gründen, die hier auszuführen nicht der Ort ist,9 kann der Mensch [S. 31] die Vorstellung einer möglichen Sinnlosigkeit der Welt und seines Daseins nicht ertragen. „In der Tat", stellte diesbezüglich der polnische Philosoph Leszek Kolakowski fest, „die Erfahrung der Gleichgültigkeit der Welt stellt uns vor die Alternative, entweder es gelingt uns, die Fremdheit der Dinge durch ihre mythische Organisation zu überwinden, oder wir werden diese Erfahrung vor uns verheimlichen in einem komplizierten System von Einrichtungen, die das Leben in der Faktizität des Alltäglichen zerreiben."10 Während der zweite Teil dieses Satzes auf die Oberflächlichkeit einer Leistungs- und Konsumgesellschaft und auf die Lobpreisung besinnungslosen Workoholikertums bezug nimmt, verweist der erste Teil auf das Fortdauern mythischer Denkmuster von denen selbst die Aufklärung nicht frei war, nämlich auf den
- Mythos der Erlösung aus den Fesseln der Unwissenheit und des Aberglaubens durch fortschreitende Ausbreitung wissenschaftlichen Denkens,
- Mythos der Versöhnung mit der Natur durch die Aufgabe der Anmaßung des Menschen, Krone der Schöpfung zu sein,
- Mythos vom ewigen Frieden durch den Abbau von Vorurteilen und durch vernunftgeleitete Machtausübung und
- Mythos vom Sinn der Welt, der sich nach der Entschleierung der Ablaufgesetze der Geschichte offenbaren würde.
Das populärwissenschaftliche Welt- und Geschichtsbild des ausgehenden 19. Jahrhunderts
Das ausgehende 19. Jahrhundert war auch die Zeit der Hochblüte des Bildungsbürgertums. Ein bürgerlicher Haushalt, der auf sich hielt, mußte zumindest einen Bücherschrank, wenn schon nicht eine Bibliothek vorweisen können, der oder die mit opulent gestalteten Büchern ausgestattet war, wollte er in der feinen, kultivierten, gehobenen, gebildeten – die Reihe dieser schmückenden Beiwörter ließe sich noch länger fortsetzen – Gesellschaft mit Anerkennung und Geltung bestehen. Die Buchverlage waren in ihren Angeboten ganz auf dieses bürgerliche Bildungs- und zugleich Repräsentationsbedürfnis eingestellt und brachten neben umfangreichen Reihen von Ausgaben aus der schönen Literatur auch aufwendig gestaltete Reihenwerke oder Einzelbände aus den Gebieten der Wissenschaften heraus, die einem interessierten, wenn auch nicht immer fachlich vorgebildeten Publikum die neuesten Erkenntnisse der Forschung nahebringen wollten. In dem Bemühen um gemeinverständliche Darstellung und um die Erfüllung der Erwartungshaltungen der Leserinnen und Leser entstand eine populärwissenschaftliche Literatur, als deren Autoren durchaus oft Universitätsprofessoren und Männer des höheren Schulwesens wirkten, welche die genannten Mythen der Aufklärung in je verschiedenem Maße, insgesamt aber doch transportierten und auf diese Weise das Weltbild und die Vorstellungswelt der Leserschaft mit formten.
Der hier vorgelegte Beitrag unterzieht drei solcher Werke einer dahingehenden Betrachtung. Es sind dies:
- Franz Sträßle, Illustrierte Naturgeschichte der drei Reiche, 4. Aufl., Stuttgart 1888.
- M. Reymond, Weltgeschichte, Neudamm 1893, 2 Bde (= Hausschatz des Wissens. Abt. VIII. Bde. 12 und 13.).
- Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes, Berlin 1886, 2 Bde.11
Bei dem letztgenannten Werk lassen Einstempelungen erkennen, daß es einmal zum Bestand der „Lehrer-Bibliothek des Schulbezirks Hietzing“ gehört hat, die beiden erstgenannten entstammen der Privatbibliothek eines hohen Beamten aus der Zeit der Ersten Republik.
Naturgeschichte
Für den Bereich der Naturgeschichte – Zoologie, Botanik, Mineralogie und Geologie – wird Franz Strässles, seines Zeichens Oberlehrer in Neckarsulm, gemeinsam mit Ludwig Baur, Professor am Königlichen. Schullehrerseminar in Saulgau, im Jahre 1888 in vierter Auflage herausgebrachtes umfangreiches Werk „Illustrierte Naturgeschichte der drei Reiche“ vorgeführt. Im Vorwort wird als Zweck dieses Buches dargelegt: „Es lag von vornherein in dem Bestreben der Verfasser, ihre Leser, und namentlich die strebsame Jugend, mit den Grundzügen der heutigen Naturwissenschaft, welcher ja eine so hohe und tiefgreifende Bedeutung in unserem modernen Kulturleben zukommt, mit den Gesetzmäßigkeiten, welche dem Werden, Sein und Vergehen der Naturkörper zu Grunde liegen, bekannt zu machen; sie wollten in dem natürlichen und oft so wunderbaren Zusammenhang der Dinge das Walten der göttlichen Allmacht, Weisheit und Güte des Schöpfers erkennen lassen und so dem menschlichen Geiste die Schönheit und Größe der irdischen Schöpfung erschließen.“12 Aus diesen Worten läßt sich eine zumindest theistische, wenn schon nicht christliche Weltanschauung erkennen. Dieser Weltanschauung entspricht es auch, daß in der Gliederung dieses umfassenden Werkes dem Menschen eine seltsame Sonderstellung zwischen dem Ende der allgemeinen und vor Beginn der speziellen Zoologie zugewiesen wurde, denn „der Mensch ist die Krone der Schöpfung“13, wie zu Beginn des Kapitels über den Menschen festgestellt, wird. „Was den Menschen aber weit über das Tier stellt, was ihn zum Herrn der irdischen Schöpfung macht, ihn auf den Thron der Welt stellt, das sind seine geistigen Eigenschaften, das ist sein denkender, vernünftiger Geist in Vereinigung mit seiner artikulierten Sprache“14, wird zur Begründung dieser Behauptung angeführt. Dieser Satz ist eine merkwürdige Vermengung des alttestamentarischen Anthropozentrismus des „wachset und vermehret euch und macht euch die Erde untertan“15 mit humanistisch-aufklärerischen Auffassungen über die Sonderstellung des Menschen in [S. 33] der Natur als Bindeglied auf der Stufenleiter von der reinen Materie der unbelebten Welt bis zur Göttlichkeit des reinen Geistes. Da es aber „den Menschen“ als Gesamtheit nicht gibt, sondern da die Gattung Mensch aus einer Vielzahl von Einzelwesen besteht, welche sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild und in ihren Lebensumständen doch erheblich voneinander unterscheiden, haben Strässle und Baur das Menschengeschlecht im Sinne der Ordnungsbestrebungen der aufklärerischen Philosophie in Rassen untergliedert. „Nach diesen Verschiedenheiten, die sich hauptsächlich auf die Hautfarbe, auf die Schädel- und Haarbildung beziehen, unterscheidet man mehrere Rassen des Menschengeschlechts. Die Ansichten über die Zahl dieser Rassen gehen freilich weit auseinander. (...) Am üblichsten ist die Gliederung in 5 Hauptstämme, als: Kaukasier, Mongolen, Äthiopen, Amerikaner und Malayen.“16
So weit, so gut. Strässle und Baur setzten nun ihre Ausführungen fort, indem sie diese fünf Hauptrassen des Menschengeschlechts näher beschrieben. Anscheinend ohne daß es ihnen auffiel verließen sie dabei den Begriff eines einheitlichen Menschengeschlechts und ergingen sich in seltsamen Klassifizierungen:
1) Der kaukasische oder mittelländische Stamm. Derselbe nimmt unbestritten unter allen die erste Stelle ein, nicht nur weil seine Abkömmlinge heutzutag über den ganzen Erdball verbreitet sind, sondern hauptsächlich deshalb, weil er derjenige Stamm ist, bei dem Moralität, Künste, Wissenschaften und Zivilisation die größten Fortschritte gemacht haben. ‚Alles, was die Wissenschaft und Kunst geleistet, ist Werk dieses rastlosen Denker- und Bildnerstammes; von ihm sind alle herrschenden Religionen ausgegangen und ein wirkliches Staatsleben hat sich immer nur bei kaukasischen Völkern entwickelt.‘ (...) Von seiner ursprünglichen Heimat, die ohne Zweifel an den Küsten des schwarzen Meeres zu suchen ist, hat sich dieser kräftige Stamm – mit Ausnahme von Lappland und Finnland – suchen ist, hat sich dieser kräftige Stamm – mit Ausnahme von Lappland und Finnland – über ganz Europa, Nordafrika, Arabien, Persien, Indien und einen großen Teil der neuen Welt ausgebreitet, überall Gesittung pflanzend und pflegend. Derselbe läßt sich in 3 Familien [S. 34] scheiden: die indogermanische (Inder, Perser, Armenier, Germanen, Slaven, Romanen und Kelten), die semitische (Juden, Syrer, Araber) und die hamitische (Berber, Altägypter und Ostafrikaner). Die Kennzeichen dieser Rasse sind: weiße (fleischfarbene) Hautfarbe, dichte, lange und weiche Haare in den verschiedensten Färbungen (blond, schwarz und fuchsig), kugelig gewölbter Schädel mit hoher offener Stirne, schmale, meist gerade Nase, freiblickendes, großes Auge, dünne Lippen und wenig hervortretende Backenknochen (...) Der Körperbau ist im allgemeinen schlank und von mäßiger Größe. (...)
2) Der mongolische Stamm. Die Völker dieser Rasse nehmen in Bezug auf geistige und gesellige Entwicklung im allgemeinen den zweiten Rang ein, im einzelnen findet man unter ihnen aber große Verschiedenheiten. Die einen derselben sind trotz der Jahrhunderte, die sie als Generationen durchlebten, in einem mehr oder minder elenden Zustande geblieben und durchstreifen noch heute wie in frühester Zeit als Nomaden die unermeßlichen Steppen des mittleren Asiens. Andere haben sich unter der Anführung kühner Häuptlinge (...) mit den Waffen in der Hand über ferne Länder verbreitet (...) Wieder andere Völker dieses Stammes führen zwar ein ruhiges Leben und kennen auch die Zivilisation, die schönen Künste, die Wissenschaften und den Handel, aber sie haben seit Jahrhunderten jedem Fortschritt sich verschlossen. (...) das eng geschlitzte, etwas schief stehende Auge hat einen scharfen und lauernden Blick und knechtischen Sinn, der einerseits auf Verschlagenheit und Klugheit, andererseits aber auch auf Falschheit hinweist, Charakterzüge, die dem mongolischen Stamme eigen sind.
3) Der äthiopische Stamm (die Negerrasse) steht auf viel tieferer Stufe als die beiden vorangehenden Stämme, denn seine Angehörigen befinden sich großenteils noch im wilden, fast tierischen Zustande und kennen im allgemeinen keine andere Religion als den Götzendienst. Nur einzelne kleine Zweige des großen Stammes machen sich auf vorteilhaftere Weise bemerklich, indem sie durch Berührung mit benachbarten Völkerschaften anderer Stämme einigermaßen Kultur annahmen. (...) Besonders gut sind die Kaumuskeln und das Gebiß des Negers entwickelt, was in Verbindung mit seinem ‚brunstartig glühenden, dunklen Auge‘ auf die in seinem Wesen vorherrschende Macht der Sinnlichkeit schließen läßt. Den Negern ähnlich sind die Hottentotten in Südafrika (...) wie die ihnen verwandten Buschmänner (...) auch ihre Lebensweise ist eine fast tierische, so daß es als kein Unglück betrachtet werden kann, wenn sie im Kampfe mit den Kulturvölkern nach und nach untergehen (...)
4) Der amerikanische Stamm umfaßt die wilden und kriegerischen Ureinwohner Nord- und Südamerikas, die Eskimos und Grönländer ausgenommen. Im allgemeinen gelten sie als ausdauernde, listige, kaltblütig-grausame Menschen, doch sind sie keineswegs Kannibalen, wie man schon vermutet hat; (...) Trifft man in Peru und Mexiko viele Spuren (Trümmer) aus alter Zeit, die auf ehemalige Bildung und Gesittung hinweisen, so verhalten sich die heutigen Abkömmlinge jener Völker, wie die Ureinwohner Amerikas überhaupt, die sog. Indianer, der Mehrzahl nach feindlich gegen die Zivilisation. Ein nicht unbeträchtlicher Teil derselben, namentlich in den vereinigten Staaten, in Mittelamerika und im nördlichen Südamerika, hat zwar seine eigentümlichen Sitten mit den europäischen vertauscht und auch den erhabenen und göttlichen Lehren des Christentums Gehör gegeben; allein die meisten führen doch lieber, in kleine Stämme zersplittert und unter Anführung ihrer Häuptlinge ein unstätes Krieger- und Jägerleben. Einige Stämme im westlichen Nordamerika sind sogar kaum über das tierische Leben erhaben und nähren sich von getrockneten Eicheln, Wurzeln, Heuschrecken und anderen Insekten. (...) Die ganze Rasse, soweit sie sich den Einflüssen der Kultur entzieht, wird von den vordringenden Europäern mehr und mehr nach Westen gedrängt, wie sich denn überhaupt die (...) An- [S. 35] zahl von Köpfen im Kampf um das Dasein von Jahr zu Jahr mindert (...)
5) Der malayische Stamm, der Australien und die ostindischen Inseln teilweise inne hat, weist eine große Mannigfaltigkeit von Mischformen auf, so daß fast alle Charaktere der übrigen Rassen in ihnen vertreten sind. Man trennt daher diesen Stamm in Australier, Papuanen und eigentliche Malayen. Die Australier sind den Negern ähnlich, unterscheiden sich aber von ihnen durch den reichlichen Haaranflug, der fast den ganzen Körper bedeckt, durch schlichtes oder leicht gekräuseltes Haar, starken Bartwuchs und weit geöffneten, unförmlichen Mund. Sie bewohnen (...) das Innere Australiens und stehen auf der Übergangslinie zur tierischen Häßlichkeit, ja man darf behaupten, daß sie die Kluft, welche den Menschen vom Tiere trennt auf bedenkliche Weise verwischen. (...) Ist der Australier stumpfsinnig und der eigentliche Malaye verschlossen, wild und rachsüchtig, so zeigt sich der Papuane fröhlich ausgelassen, voll Neugierde und hat große Freude an buntem Schmuck und lärmendem Gesang.“17
In reichlich willkürlicher Anordnung, versetzt mit Urteilen des persönlichen Geschmacks, ideologisch bestimmten Wertungen, Vorurteilen und überheblicher Herablassung wurden hier Menschengruppen in Rassen eingeteilt, ohne daß den beiden Verfassern die Haltlosigkeit ihrer Rassengliederung bewußt geworden wäre. Unter den mit den Humanwissenschaften befaßten Wissenschaftern waren derartige Rasseneinteilungen immer wieder umstritten, sei es wegen der Zuweisung einzelner Menschengruppen zu bestimmten Rassengruppen, sei es wegen der Zuschreibung bestimmter Charaktereigenschaften zu bestimmten Rassen. „Einige dieser Einteilungen“, meinte – allerdings etwa zwanzig Jahre nach Strässle und Baur – einer dieser Wissenschafter, „legen auf die somatischen Eigenschaften das größte Gewicht, andere auf die sprachlichen, wieder andere auf die geographische Verbreitung; alle leiden an den Folgen, die naturgemäß den künstlichen Einteilungen überhaupt anhaften, und trennen Rassen, die sicher nahe verwandt sind, oder bringen völlig getrennte Rassen in unmittelbare Nähe. (...) Tatsächlich befriedigt uns kein einziger der bisher vorhandenen Einteilungsversuche. Es kann sogar behauptet werden, daß auch alle zukünftigen Versuche dieser Art zwar im einzelnen richtiger und reicher gegliedert sein werden, aber deshalb doch nicht dem tatsächlichen Befund wirklich entsprechen können.“18
Zwar wurde auch in dieser Äußerung der Begriff der Rasse nicht gänzlich verworfen, aber immerhin wurde in Frage gestellt, ob dieser Begriff jemals einer zufriedenstellenden Definition zugeführt werden könnte. Man konnte und wollte aber auch nicht auf derartige Ordnungskriterien verzichten, denn sie nährten im Menschen auch die narzißtisch-magische Vorstellung, daß die Flucht der Erscheinungen gebannt und beherrscht werden könnte, wenn man sie einem Ordnungssystem unterwürfe. „Schon sein Ordnungswille, der den ganzen Kosmos in einem System von Bildern und Begriffen zu erfassen suchte, nährte sich aus jener narzißtischen Energie“19, kommentierte Mario Erdheim dieses beharrliche Streben des Menschen nach Ordnung, das selbst den bestirnten Nachthimmel in Sternbilder gliederte, damit aus dem Chaos ein Kosmos20 werde. Gerade eine Epoche wie die Aufklärung, in der die intellektuellen Kreise Gott zunehmend in den Hintergrund drängten, verlangte ein Werkzeug, das dem Menschen die Illusion bieten konnte, nun selbst der Beherrscher der Welt zu sein, und Carl von Linné (1707-1778) schuf es im Jahr 1735 mit seinem „Systema naturae“, der durchgehenden Ordnung und Klassifizierung aller damals bekannten Pflanzen und Tiere.
In dieser Denktradition standen Strässle und Baur mit ihrer „Illustrierten Naturgeschichte der drei Reiche“. In ihr wirkte noch der Einfluß einer aus aufklärerischem Vernunftglauben und verschwommenem Gottesglauben ver-[S. 36]mischten Weltanschauung. „Allem Widerwillen der Aufklärung gegen den christlichen Glauben zum Trotz“, beschrieb George L. Mosse Entstehung und Inhalt dieser Weltanschauung, „konnte sie nicht ohne einen Gott auskommen, der Mensch, Moral und Universum in einem großen Plan zusammenfaßte. Dieser Gott sollte dem Menschen und der Natur innewohnen: eine Gottheit, die sich nur in der Ordnung der Natur und im Verhalten des Menschen offenbarte. (...) Ein solcher Deismus, wie er oft genannt wurde, bestärkte die Suche nach der Einheit von Mensch und Natur, ja von Menschen und allem, was sein Leben bestimmte. (...) Gottes Universum zu verstehen, hieß für den Aufgeklärten, daß der Mensch ein wesentlicher Bestandteil der Natur sei, ein Glied in der ungebrochenen ‚Scala naturae‘21 (...) Der mächtige Mythos von der ‚scala naturae‘ erklärt, warum die Wissenschaftler so sehr damit beschäftigt waren, die ‚fehlende Verbindung‘ in der Schöpfung zu finden, die den Menschen in einer ununterbrochenen Stufenfolge des Lebens mit den Tieren verband. So reichte denn (...) auch das höchste Tier, für das man normalerweise den Affen hielt, an die niederste Menschenart, für die man gewöhnlich die Schwarzen hielt.“22 Dieser Minderachtung der dunklen Menschen hatte ihre Wurzeln einerseits darin, daß sie in ihrem Erscheinungsbild von dem das Schönheitsempfinden und damit Wertempfinden der Aufklärung bestimmenden ästhetischen Kanon der klassischen Antike erheblich abwichen, und andererseits darin, daß sie von den im christlichen Pietismus des 18. Jahrhunderts und in der Romantik des 19. Jahrhunderts auflebenden manichäischen23 Denkmustern wegen ihrer dunklen Farbe zunächst unbewußt und in der Folge „wissenschaftlich“ begründet auf die Seite des Bösen und Minderwertigen gestellt wurden.24 Aus diesen Denkmechanismen heraus versteht sich die Ernsthaftigkeit mit der Strässle und Baur ihre Werturteile über die einzelnen von ihnen bezeichneten Menschenrassen bis hin zur leichthin – wissenschaftlich-(sozial)darwinistisch begründeten – vorgebrachten Rechtfertigung der Ausrottung der „Wilden“ durch die europäischen „Kulturmenschen“ abgaben und auch die, wie anzunehmen ist, unhinterfragte Aufnahme durch die Leserschaft.
Wie sehr Strässle und Baur mit ihren Auffassung dem wissenschaftlichen Zeitgeist entsprachen, erweist sich daran, daß auch die führenden Köpfe der anthropologischen Wissenschaft ihrer Zeit in den gleichen Vorurteilen befangen waren. So äußerte sich beispielsweise Thomas Huxley über die Unterschiede zwischen Weißen und Schwarzen wie folgt: „Es mag durchaus stimmen, daß manche Neger besser sind als manche Weißen (!); aber kein vernünftiger Mensch, der die Fakten kennt, glaubt, daß der durchschnittliche Neger dem durchschnittlichen Weißen ebenbürtig, geschweige denn überlegen ist. Und wenn das stimmt, läßt es sich einfach nicht glauben, daß unser Verwandter mit dem vorspringenden Kiefer, nachdem all seine Benachteiligungen beseitigt sind und er einen von Begünstigung und Unterdrückung freien Entfaltungsraum hat, erfolgreich mit seinem Rivalen, der über das größere Gehirn und den kleineren Kiefer verfügt, in einem Wettbewerb konkurrieren kann, der durch Denken und nicht durch Beißen ausgetragen wird.“25 Mit welcher Blindheit und ideologischen Dünkelhaftigkeit dieses Urteil gefällt worden ist, zeigt sich darin, daß Huxley aus dem ihm zur Verfügung stehenden Material bei nüchterner und sachbezogener Untersuchung hätte erkennen müssen, „daß die Japaner im Verhältnis zu ihrer kleinen Statur mehr Hirn haben als der Durchschnittseuropäer!“26 Wie Huxley einen allenfalls darauf begründeten Überlegenheitsanspruch jener über die Europäer abgewehrt hätte, wäre amüsant zu verfolgen gewesen.
Im Abschnitt ihrer Naturgeschichte, der die Geologie und Erdgeschichte behandelt, unternahmen Strässle und Baur große Anstrengungen, um ihre „Leser, und namentlich die strebsame Jugend“ in ihrem Glauben nicht zu ver- [S. 37] unsichern. Angesichts der zu ihrer Zeit bereits bekannten und von ihnen auch vorgeführten Tatsachen, die eine Entwicklungsgeschichte der Erde von ihren Anfängen bis in die Gegenwart beweisen, mußten sie denn auch zugestehen: „Allein wir können unmöglich annehmen, daß die Erde so wie sie uns entgegentritt aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen, daß sie stets ihre jetzige Form gehabt habe. Alles weist darauf hin, daß sie auch eine Entwicklung durch Gottes Weisheit und Allmacht durchgemacht hat.“27 Mit dieser Aussage standen die Verfasser allerdings eindeutig im Widerspruch zur jüdisch-christlichen Schöpfungslehre, nach der Gott in einem sechstägigen Schöpfungsakt die Welt so erschaffen hätte, wie sie gegenwärtig ist. Von Erdzeitaltern und ihren verschiedenen Formen und Entwicklungsstufen des Lebens ist in den biblischen Berichten nichts zu lesen. Strässle und Baur vertraten, wie bereits gesagt wurde, eine der Aufklärung verpflichtete eher deistische Gottesauffassung, wonach Gott seiner Schöpfung auch ihre Entwicklungsgesetze eingegeben hätte und sich seither um sie nicht mehr kümmere. Allerdings konnten sie diese Gottesanschauung nicht ungebrochen aufrecht erhalten. War es ihnen etwa noch möglich, die Entstehung des Sonnensystems und der Erde mit der für den damaligen Wissensstand einigermaßen schlüssigen Kant-Laplaceschen Hypothese28 zu erklären, so mußten sie für die Entstehung des organischen Lebens auf der Erde doch noch einmal einen schöpferischen Eingriff Gottes annehmen. „Die Art und Weise aber der ersten Entstehung von Pflanzen und Tieren“, mußten sie vom Stand des damaligen Wissens aus eingestehen, „ist uns vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus ein vollständiges Rätsel, da wir heutzutage keine Pflanze und kein Tier ohne Eltern entstehen sehen.“29 Strässle und Baur begnügten sich mit dieser Feststellung und mußten dies auch gemäß dem Wissensstand ihrer Zeit auch tun.30 Sie begnügten sich auch damit, die Entwicklungsgeschichte von Flora und Fauna über die verschiedenen Erdzeitalter hinweg abzuhandeln, auch dies, ohne ein Wort über die Ursachen dieses dauernden Wandels der Lebensformen zu verlieren. Sie schlossen ihr Werk sodann mit den Worten: „(...) denn nichts hat hienieden eine bleibende Stätte, alles ist in Entwicklung und Veränderung begriffen nach den ewigen und unveränderlichen Gesetzen dessen, der da Himmel und Erde erschaffen hat und den wir desto mehr verehren und lieben werden, je mehr wir uns in die Schönheit und Größe seiner unendlichen Schöpfungen versenken!“31
Mit diesem Satz unternahmen Strässle und Baur einen letzten Versuch, angesichts der fortschreitenden „Entzauberung der Welt“ durch die Wissenschaften sowohl der Erdgeschichte als auch der in sie eingebetteten Geschichte des Menschen doch noch einen Sinn zu unterlegen, und sei es bloß der, daß der Gang der Weltgeschichte gemäß den in sie eingepflanzten Gesetzen des Schöpfers auf die Vorherrschaft der weißen Rasse abgezielt hätte. Sie machten aber mit ihrer Gedankenführung überdies den Versuch, vom Christentum mit seinem zunehmend unhaltbarer werdenden Dogmengebäude zumindest eine verschwommene Gottgläubigkeit zu retten, um dem Gottesgnadentum der damaligen deutschen Monarchen, in deren Schuldienst sie ja standen, wenigstens noch ein Quäntchen an Legitimation zu erhalten und damit auch zum Fortbestand der hierarchisch gegliederten Gesellschaftsordnung beizutragen. Diese diffuse Gottgläubigkeit sollte sich tatsächlich wenige Jahrzehnte später noch als wesentliche Stütze der totalitären faschistischen Regimes in Europa erweisen, weil sie sich ohne Schwierigkeiten mit dem beispielsweise von Adolf Hitler (1889-1945) in seinen Reden immer wieder beschworenen Glauben an die Vorsehung vereinen ließ.
Geschichte
Sahen Strässle und Baur die Ausrottung der „Wilden“ durch die „Kulturvölker“ als unausweichlichen, naturgemäßen Vorgang im Sinne [S. 38] der Darwinschen Selektionstheorie an, so wurde die Vorstellung des „Kampfes ums Dasein“ auch als Grundprinzip auf den Ablauf der Geschichte übertragen. Ein Beispiel hierfür bietet M. Reymond mit seiner im Jahre 1893 erschienenen zweibändigen „Weltgeschichte“. In Erkenntnis der alle bisherigen Weltanschauungen umstürzenden Kraft der Anwendung des entwicklungsgeschichtlichen Denkmodells auf die Erscheinungen der Natur und die Geschichte eröffnete er seinen Leserinnen und Lesern vorsichtig die neue Sichtweise der Geschichte:
„Während wir also früher die Entstehung der Welt als einen Schöpfungsakt auffaßten, welcher in der Erschaffung des Menschen als des vollkommensten und vornehmsten aller Geschöpfe seinen endgiltigen Abschluß gefunden hat, sehen wir jetzt alles Bestehende als das Ergebnis eines Entwickelungsprozesses an, der an und für sich nicht an zeitliche und räumliche Grenzen gebunden ist, obgleich er sich unserem Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögen nur innerhalb solcher Grenzen darstellt. Diese der wissenschaftlichen Erfahrung unserer Zeit entsprechende Anschauungsweise gestattet nicht länger, für den Menschen oder den von ihm bewohnten Weltkörper eine Ausnahms- und Vorzugsstellung zu beanspruchen, denn beide sind nichts, als Glieder in der unendlichen Entwickelungsreihe, die alles Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige in sich schließt. Es wäre eine ganz willkürliche, nur aus Eitelkeit oder Kurzsichtigkeit zu erklärende Annahme, daß diese Entwickelungsreihe mit dem Menschen überhaupt oder gar mit dem Menschen, wie er jetzt ist, abgeschlossen sei (...)“32. Damit hatte Reymonds eine Leserschaft darauf eingestimmt, die liebgewordene Vorstellung abzustreifen, daß die Welt und damit auch jeder Mensch sicher in Gottes Hand ruhten und jedes Schicksal seinen von Gott gegebenen Sinn hätte. Als Ausgleich für den Verlust an Sicherheit, den die Zerstörung des überkommenen Weltbildes der Religionen unweigerlich mit sich bringen mußte, bot Reymonds einem Publikum den Trost, daß eine wissenschaftliche Weltanschauung einen höheren sittlichen Wert hätte als eine religiöse: „Weit entfernt, durch diese Auffassung an wissenschaftlichem und sittlichem Werte zu verlieren, kann die Weltgeschichte vielmehr nur dann zu einem wahrhaften, fruchtbringenden Bildungsmittel für den einzelnen, wie das Menschengeschlecht in seiner Gesamtheit werden, wenn sie sich auf die natürliche Grundlage des Entwickelungsgesetzes stellt und die Erklärung der Ereignisse, welche ihren Inhalt bilden, nicht – im Geiste der älteren Weltanschauung – in dem Walten und der fortdauernden fürsorglichen Leitung höherer Mächte, sondern in der Menschennatur selbst und deren fortschreitender Entwickelung sucht. Sie wird dadurch nicht nur dem allgemeinen Verständnis, sondern auch der Wahrheit näher gerückt werden, deren Verdunkelung unvermeidlich ist, sobald man sich mit Anschauungen abfinden muß, welche nicht auf Erfahrung, sondern bloß auf Vorstellungen beruhen, deren Richtigkeit nicht nachgewiesen werden kann, weil sie auf ein, unserer Erkenntnisfähigkeit nicht zugängliches Gebiet übergreifen.“33
Reymond ging dann im Sinne seiner Auffassung, den Menschen als Naturwesen zu begreifen, dessen kulturelle Entwicklung einerseits von seinen Anlagen, andererseits von den naturgegebenen Rahmenbedingungen seines Daseins abhängig ist, daran, die Weltgeschichte als Abfolge von kulturellen Aufstiegs- und Niedergangsbewegungen zu erklären, die in den genannten natürlichen Ursachen begründet wären. „Und nicht bloß der Kulturmensch, auch seine Schöpfungen, seine gesellschaftlichen und staatlichen Einrichtungen, ja selbst seine Fortschritte auf dem Gebiete der rein geistigen Arbeit erweisen sich nur bis zu einem gewissen Grade entwickelungsfähig; Stillstand, Rückgang und Verfall gelangen auch hier – je nach den Umständen rascher oder langsamer, sprungweise oder stetig – zur Geltung. Die Entwickelung steht deshalb nicht stille; sie setzt nur an anderen Punkten an und schlägt andere Richtungen ein. Es ist in der Natur dafür ge-[S. 39]sorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen, weil sie sonst alles übrige Wachstum ersticken würden. Auch die Kultur würde durch einseitige und übermäßige Entwickelung schließlich das Naturleben unserer Erde ersticken; da aber ihr Urheber selbst in erster Reihe und am empfindlichsten von den hieraus entstehenden nachteiligen Folgen betroffen würde, so ist auf ganz natürliche Weise dafür vorgesorgt, daß auch dieser starke Baum nicht in den Himmel wächst.“34 Nach dieser erstaunlichen Vorausahnung der ökologischen Probleme, die ein ungehemmtes Wachstum der Menschheit und ihrer Zivilisation nach sich ziehen würde, und die in der Gegenwart auch tatsächlich bestehen, kehrte Reymond wieder zur weiteren Erläuterung seiner Geschichtsauffassung zurück. Wenn die kulturelle Entfaltung des Menschen nur im Wechselspiel zwischen seinen natürlichen Anlagen und seinen natürlichen Lebensbedingungen möglich wäre, dann bedürfte es bestimmter begünstigender Umweltbedingungen, um eine derartige Entfaltung zu ermöglichen und anzuregen. Es wäre demnach kein Zufall, daß die kulturelle Aufwärtsentwicklung des Menschen in den dieser zuträglichen Landstrichen Chinas, Indiens, des Zweistromlandes, Ägyptens, Griechenlands, Italiens und Mittelamerikas ihre Anfänge genommen hatte. Australien wäre hingegen von Anbeginn bis in die Gegenwart jeder Ausbildung von Kultur feindlich gewesen, womit Reymond die niedere Kulturstufe der Australier quasi „sachlich“ begründete und nicht, wie Strässle und Baur, ideologisch abwertete.
Kultur bestand für Reymond aus zwei Bestandteilen: aus der Sprache und aus der Kunst. Die Sprache und ihre dauerhafte Aufzeichnung in der Schrift hätten den Menschen instand gesetzt, „sein Denken und Urteilen auf Dinge zu erstrecken, die außerhalb des Bereichs seines unmittelbaren Gesichtskreises liegen, Wahrnehmungen und Erfahrungen anderer ohne Rücksicht auf Zeit und Ort ihres Ursprunges sich nutzbar zu machen, die empfangenen Eindrücke in Einzelbegriffe zu zerlegen und als solche sowohl für den eigenen Gebrauch als auch zum Zwecke der Mitteilung an andere festzuhalten, um ihrer je nach Bedarf als Bausteine zu neuer Gedankenbildung zu bedienen“35. Die Kunst ist im in diesem Zusammenhang verwendeten Sprachgebrauch Reymonds die Fähigkeit des Menschen, sich „künstliche“ Hilfsmittel über die natürlichen hinaus für den Daseinskampf zu verfertigen und zu vervollkommnen. Verbunden mit dem Erfahrungsaustausch durch die Sprache ergab sich daraus für den Menschen im Kampf ums Dasein ein erheblicher Wettbewerbsvorteil gegenüber den Tieren. „Bei den Tieren geht die Vervollkommnung der vererbten Fähigkeiten auf dem Wege der Anpassung nur äußerst langsam und lediglich infolge der Nötigung durch die gegebenen Lebensbedingungen vor sich, sodaß hier der Fortschritt eher hinter dem Bedürfnis zurückbleibt als über dasselbe hinausgeht (...) Der Entwickelungsgang der Menschheit eines bestimmten Zeitalters beginnt hingegen da, wo derjenige des vorangegangenen Geschlechts sein Ende erreicht hat, und nur die von der Natur hinsichtlich unserer Lebensdauer und der Leistungs- und Entwickelungsfähigkeit unserer Sinneswerkzeuge gesetzten Schranken, sowie die in den äußeren Umständen und Lebensverhältnissen liegenden Hemmnisse verhindern den Fortschritt ins Unendliche, oder verlangsamen denselben mindestens.“36 Dieser durch Sprache, die von Reymond hier als Synonym für Wissenschaft gebraucht wird, und Kunst, besser gesagt durch technische Kunstfertigkeit, kurz, dieser durch Wissenschaft und Technik ermöglichte Fortschritt war für ihn gleichbedeutend mit Kultur, deren Hochstand er danach bemaß, wie sehr sie über die Gewährleistung des Lebensnotwendigen hinausreichte.
Unversehens schlich sich aber auch in die anscheinend so rein sachlich-naturwissenschaftlich begründete Geschichtsauffassung Reymonds doch die ideologisierende Bewertung ein. Es genügte ihm nicht, den Verfall von Kulturen auf ihre naturgegebenen Ra- [S. 40] hmenbedingungen zurückzuführen. Er entkam letztlich nicht seinen unbewußt wirkenden kleinbürgerlich-puritanischen sittlichen Beurteilungen, wenn er von auch zu seiner Zeit zu bemerkenden „Krankheiten der Überkultur“37 wie Genußsucht, Verweichlichung, Entnervung, sittliche Entartung und dergleichen mehr sprach.
Mit angeblich wissenschaftlichen Begründungen unkenntlich gemacht und auf ferne Kulturen projiziert, ließ Reymond dem kleinbürgerlichen Lebensgefühl von „Feindseligkeit und Ressentiment“38 freien Lauf. Mit kleinbürgerlich wird hier im Sinne Erich Fromms (1900-1980) die gesellschaftliche Befindlichkeit einer Bevölkerungsschichte umschrieben, die eifrig bemüht war, sich von den unruhigen, umstürzlerischen Arbeitermassen in den primitiven Zinskasernen der industrialisierten Vorstädte deutlich abzuheben, in ihrem Wohl und Wehe aber von der Oberschicht abhängig war. Leistungswille und Verzichtbereitschaft erwiesen sich als die persönlichen wie schichtspezifischen Charaktereigenschaften, die zur Bewahrung und Verbesserung der kleinbürgerlichen Lebenssituation in der Gesellschaft nützlich und erforderlich waren. Die Bewahrung dieses Status hatte allerdings auch ihren Preis: „Jeder, der in bezug auf sein Gefühl und Sinnenleben frustriert ist und sich noch dazu in seiner Existenz bedroht fühlt“, erläuterte Fromm diesbezüglich: „wird normalerweise feindselig reagieren. Wie wir sahen, waren der Mittelstand und besonders jene Bürger, die sich noch nicht der Vorteile des emporkommenden Kapitalismus erfreuen konnten, benachteiligt und schwer in ihrer Existenz bedroht. Und noch etwas anderes verstärkte ihre Feindseligkeit: der Luxus und die Macht, welche die kleine Gruppe der Kapitalisten – einschließlich der hohen Würdenträger der Kirche – zur Schau stellen konnten. Ein intensiver Neid gegen sie war die Folge. Aber die Angehörigen des Mittelstandes hatten – im Gegensatz zu den unteren Bevölkerungsschichten – keine Möglichkeit, diese Feindseligkeit und diesen Neid offen zu äußern. Die Mittellosen haßten die Reichen, von denen sie ausgebeutet wurden, sie versuchten, ihnen, ihre Machtstellung zu nehmen und konnten es sich leisten, ihrem Haß freien Lauf zu lassen. Auch die Oberschicht konnte es sich erlauben, ihrer Aggressivität in ihrem Machtstreben direkten Ausdruck zu verleihen. Dagegen war die Mittelschicht im wesentlichen konservativ. Wer dazu gehörte, wollte die Gesellschaftsordnung festigen und nicht umstürzen. Jeder hoffte, voranzukommen und an dem allgemeinen Aufschwung teilzuhaben. Daher durfte man seine feindseligen Gefühle nicht offen äußern, ja man durfte sie sich nicht einmal bewußt machen; man mußte sie verdrängen.“39 Damit waren diese Gefühle aber nicht aus der Welt geschafft, sie drängten vielmehr um so stärker nach Ausdruck. Dies konnte in ungefährlicher Weise geschehen, indem man sie gegen längst untergegangene Völker und Kulturen oder gegen unterdrückte und wehrlose Minderheiten richtete. Reymond beschritt den ersten Weg, indem er seine verinnerlichten Vorstellungen von Sitte und Moral als der Natur entsprechend überhöhte und von dieser Höhe aus über die untergegangenen Kulturen zu Gericht saß: „Allein derselbe Umstand, welcher auf die Entstehung einer höheren Kultur fördernd gewirkt hatte, bewirkte auch den Verfall derselben durch üppige Ausartung, Verweichlichung, geistige Trägheit. Die thatkräftigeren, durch die Sprödigkeit und Rauheit der Natur ihres Wohnortes in höherer Spannkraft erhaltenen Völker Europas bemächtigten sich der Kultur des asiatisch-afrikanischen Südens, bildeten dieselbe nach ihren Bedürfnissen und Anschauungen weiter aus und bewirkten so, da diese Kultur gleichzeitig an ihren Heimstätten immer mehr und mehr in Verfall geriet, beziehungsweise dem Einflusse der neuen Machthaber weichen mußte, eine vollständige Verschiebung der Kulturzone der alten Welt in die Richtung von Südost nach Nordwest, oder, wenn wir die alten geographischen Bezeichnungen für die Kulturländergruppen des Ostens und Westens unserer Erdhälfte beibehalten [S. 41] wollen, vom Morgen- nach dem Abendlande, und in späterer Zeit über das letztere hinaus nach der neuen Welt hinüber.“40
Damit war nun Reymond zu einer Geschichtsauffassung gekommen, in der die Tugenden der Enthaltsamkeit, der Abhärtung und der Sittenstrenge, die Tugenden eben, die das Bürgertum brauchte, um im wirtschaftlichen Wettbewerb bestehen zu können, als die den Lauf der Geschichte bestimmenden Kräften betrachtet wurden. Wichtig und entscheidend waren diese Tugenden nämlich nicht nur, weil sie nicht nur beim Kampf ums Dasein mit der Natur begünstigend wirkten, sondern auch, weil nach der Auffassung Reymonds der Ablauf der Geschichte überhaupt eine Aufeinanderfolge von Kulturkämpfen auf immer höherer Ebene wäre. Reymond gliederte die Weltgeschichte demnach in fünf Perioden des „Kulturkampfes“, und zwar:
1. Das Zeitalter des Kulturkampfes ums Dasein.
2. Das Zeitalter des Kulturkampfes zwischen Morgenland und Abendland.
3. Das Zeitalter des romanisch-germanischen Kulturkampfes.
4. Das Zeitalter des christlichen Kulturkampfes.
5. Das Zeitalter des wissenschaftlichen und nationalen Kulturkampfes.41
Welche Vorstellungen Reymond mit dem Begriff des „Kulturkampfes“ in seiner Weltgeschichte verband, geht anschaulich aus seiner Zusammenfassung des Zeitalters des romanisch-germanischen Kulturkampfes hervor: „Übrigens hat es sich zu allen Zeiten und bei allen geschichtlichen Völkern gezeigt, daß die drei Hauptrichtungen der Kulturentwickelung: Kunstfertigkeit, geistige und sittliche Bildung, niemals im gleichen Verhältnisse vorgeschritten sind, sondern daß viel mehr, wenn einmal eine gewisse Stufe des allgemeinen Kulturfortschrittes erreicht war, Stillstand oder Rückschritt in der einen oder anderen Richtung eingetreten ist, ja daß sich sogar diese Entwickelungsrichtungen gegenseitig zu widerstreben scheinen. Eine ebenso bestimmt erwiesene Thatsache ist es, daß große Kulturunterschiede innerhalb eines Volkes oder mehrerer in Gemeinschaft lebender viel leichter zur Unterdrückung und unter Umständen sogar zum Untergange des kulturschwächeren Teiles, als zu allmäligem Ausgleiche durch Emporheben dieses letzteren führen. Auch der germanischen Kultur hat ihre Verschmelzung mit der römischen nur hinsichtlich der Entwickelung der Kunstfertigkeit und der Hebung der geistigen Bildung Vorteil gebracht, in sittlicher Beziehung hat das germanische Wesen durch diese Verschmelzung unleugbar viel verloren. Wie bereits erwähnt, hat auch das Christentum dadurch, daß es aus den niedrigen Volkskreisen bis zu den Thronen emporstieg und mit der abendländischen Hochkultur verwuchs, nicht gewonnen; es konnte vielmehr durch seine Entwickelung nach dieser Richtung nur an seinem ursprünglichen Werte Einbuße erleiden, da jene Hochkultur mit ihren Ansprüchen und Bestrebungen in schroffem Gegensatze zu seinen vom Weltlichen abgekehrten, demütig schlichten Wesen stand. Immerhin hat das Eingreifen dieser beiden treibenden Kräfte in den Gang der allgemeinen Kulturentwickelung dieser letzteren nachhaltigen Nutzen gebracht: Der Rückfall in das morgenländische Königpriestertum wurde durch den altererbten germanischen Unabhängigkeitssinn gemildert und in seinen Folgen abgeschwächt und die Vielgötterei wurde durch die Verbreitung des Christentums dauernd aus der Kulturwelt verdrängt, wenngleich in dem Bilder-, Reliquien- und Heiligendienste der christlichen Kirche ein zäher Niederschlag derselben noch immer zurückgeblieben ist.“42
Während die Kirche immer mehr verludert und verlottert wäre, setzte Reymond seine Darstellung fort, bereitete germanisch-deutscher Geist das „Zeitalter des christlichen Kulturkampfes“ vor. Die deutsche Erfindung der Buchdruckerkunst ermöglichte eine bis dahin noch nie dagewesene Ausbreitung des Wissens, auf dem die andere deutsche Errungenschaft, die Reformation, aufbauen konnte. Da-[S. 42]mit hatte der „christliche Kulturkampf, das will sagen der Kampf des christlichen Volkes gegen die unchristlich gewordene Kirche“43 seinen ersten Höhepunkt erreicht. Allerdings: „Dieser christliche Kulturkampf, dem man in neuester Zeit schlechtweg die Benennung ‚Kulturkampf‘ gegeben und damit seine außerordentliche Bedeutung für die allgemeine Kulturentwickelung gebührend hervorgehoben hat, ist bekanntlich (...) noch heute nicht vollständig ausgetragen.“44 Noch immer seien weite Teile Europas der Macht und der Herrschaft der in Reymonds Sichtweise „entarteten“ römischen Kirche unterworfen.
Im 19. Jahrhundert sah Reymond vor allem durch die Schaffung eines deutschen Nationalstaates den endgültigen Durchbruch des Nationalitätsprinzips verwirklicht. „(...) die grundsätzliche Anerkennung, die sich der nationale Gedanke im Staatsleben unserer Zeit errungen, und die thatsächlichen Erfolge, die er aufzuweisen hat, bedeuteten unter allen Umständen einen wichtigen Fortschritt in der Entwickelung des Völkerlebens, und dieser Fortschritt verleiht dem Staatsleben des Zeitalters, in welchem wir stehen, ein so auffälliges Gepräge, daß wir dasselbe mit Recht das Zeitalter des nationalen Kulturkampfes nennen dürfen.“45 Ein besonderes Kennzeichen dieses Zeitalters bilde die allgemeine Wehrpflicht, führte Reymond weiter aus, die den Stellenwert des Soldatischen stark erhöht habe. Die Zukunft gehöre daher dem „Volk in Waffen“46, denn im Falle eines Krieges werde es keinen Unterschied mehr zwischen Bürgern und Soldaten geben. Reymond sah hier sehr klarsichtig den Weg zum totalen Krieg vorgezeichnet, wie er ein halbes Jahrhundert später dann auch geführt werden sollte. Den Grundgedanken seines Werkes, daß der Kampf der Vater aller Dinge sei, zog er allerdings angesichts dieser Aussichten nicht in Zweifel. Ganz im Gegenteil. Dem Geist der Zeit entsprechend, war die Geschichtsauffassung Reymonds von der Annahme bestimmt, daß die germanischen Deutschen diesen nationalen und wissenschaftlichen Kulturkampf für sich entscheiden würden. Unausgesprochen, aber wohl doch mitgedacht war damit auch die Vorstellung, daß damit auch das Ziel und Ende der Geschichte erreicht worden wäre.
Die Vorstellung, daß der Gang der Geschichte eine Abfolge von gewaltigen Kämpfen wäre, entsprach durchaus dem manichäisch getönten Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Auch Karl Marx (1818-1883) und Friedrich Engels (1820-1895) stellten in ihrem im Jahr 1848 veröffentlichten „Manifest der kommunistischen Partei“ fest: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“47 Auch im Geschichtsbild dieser beiden Männer kommt diese Abfolge von Kämpfen erst zur Ruhe. wenn das elitäre Subjekt der Geschichte, bei ihnen ist es das Proletariat, gesiegt und damit den Lauf der Weltgeschichte an sein Ziel gebracht hat.
Die Germanenschwärmerei
Mit seiner Geschichtstheorie, wonach die Weltgeschichte ihre Erfüllung im Aufstieg und endgültigen Sieg des deutschen Volkes fände, gab Reymond dem noch schwachen Selbstwertgefühl des im wilhelminischen Deutschland aufkommenden „ganz neuen Typs des Deutschen: des Erfolgsmenschen, der an ‚Blut und Eisen‘, an Industrialisierung und Rüstung, an Kruppstahl und die Notwendigkeit einer Reichsflotte glaub“48, eine ersehnte Stütze. Er reihte sich damit ein in den Chor der universitären Geschichtsklitterer, die der noch jungen deutschen Nation – jung deswegen, weil sie sich erst im Jahre 1871 einen eigenen Nationalstaat hatte schaffen können – eine lange und ehrwürdige Geschichte schenken wollten, indem sie diese mit den alten Germanen in eins setzten. Bereits im Jahre 1876 veröffentlichte Felix Dahn (1834-1912)49 den ersten Band seines monumentalen Romans „Ein Kampf um Rom“, dem in den folgenden zwei Jahren noch drei weitere folgen sollten. Liebe und Haß, Treue und Verrat, Aufrichtigkeit und Ranküne begleite-[S. 43]ten und lenkten in diesem literarischen Historiengemälde die Bedrängnis, den letzten Triumph und den Untergang der Ostgoten und die Rettung der letzten Reste des Volkes nach Thule in den Jahren vom Tode des Königs Theoderich (453-526; König seit 474) bis zur letzten Schlacht am Vesuv im Jahre 553. Dieser Roman traf genau die Stimmung des seine nationale Identität suchenden Bürgertums des jungen Deutschen Kaiserreiches und wurde ein großer Erfolg. In immer neuen Auflagen prägte dieser Roman das Geschichtsbild von Generationen und vermittelte ihnen subtil den Stolz auf die Zugehörigkeit zur germanischen, soll heißen deutschen Edelrasse und die Verachtung für die Verrottetheit und Verworfenheit des welschen Wesens. Etwas mehr als zehn Jahre nach dem Erscheinen des „Kampfes um Rom“ trat in Österreich Guido von List (1848-1919) in die Fußstapfen Dahns. Im Jahre 1889 erschien sein zweibändiger Roman „Carnuntum“50. Er schilderte darin die stets tapferen, kraftvollen und sittenreinen Germanen bei der Rückeroberung der angeblich verlotterten und sittenlosen römischen Garnison Carnuntum im Jahre 375 und die Errichtung eines neuen germanischen Reiches. Sechs Jahre später gelang ihm ein weiterer literarischer Erfolg mit dem zweibändigen Roman „Pipara“51, der im 3. Jahrhundert spielt und den Aufstieg eines germanischen Mädchens aus dem Stamme der Quaden zur römischen Kaiserin erzählt. List erfüllte mit seinen Romanen und seinen zahlreichen anderen dichterischen und (pseudo)wissenschaftlichen Werken die verbreiteten Sehnsüchte der nationalistisch eingestellten Deutschösterreicher, doch ebenfalls als Teil der großen, glorreichen deutschen Nation zu gelten.
Die Gleichsetzung von Germanen und Deutschen war bei den deutschen Historikern des 19. Jahrhunderts zunehmend allgemeine Übung geworden. In der groß angelegten „Römischen Geschichte“52 Theodor Mommsens (1817-1903) läßt sich beobachten, daß er die Begriffe „Deutsche“ und „Germanen“ als gleichbedeutend verwendete. So berichtete er etwa, daß der römische Kaiser Titus Flavius Vespasianus (9-79; Kaiser seit 69) zwei Legionen, die sich der Meuterei des Iulius Civilis angeschlossen hatten, die Möglichkeit gab; „gegen die Deutschen zu kämpfen und (...) ihre Schuld einigermaßen zu sühnen“.53 An anderer Stelle wußte er zu erzählen, daß der römische Kaiser Marcus Aurelius Antoninus IV., genannt Caracalla (186-217; Kaiser seit 211), einer Abordnung Germanen „in silberbeschlagener Jacke und Haar und Bart nach deutscher Art gefärbt und geordnet“54 gegenübergetreten wäre. War dieser Sprachgebrauch bei Mommsen noch vereinzelt, nahm er in späteren Jahren vor allem in populärwissenschaftlichen Geschichtswerken zu, die die deutsche Geschichte in die germanische Zeit zurückverlängern und die Germanen als die „alten Deutschen“ für den deutschen Nationalismus vereinnahmen wollten.
Ein Beispiel hierfür ist das im Jahre 1886 erschienene zweibändige Werk „Kulturgeschichte des deutschen Volkes“ von Otto Hen- [S. 44] ne am Rhyn. Als Schweizer schrieb er sein Werk von der Warte eines Deutschen, dessen Heimat außerhalb der Grenzen des wilhelminischen deutschen Kaiserreiches lag. Wollte er dennoch seine Zugehörigkeit zum Deutschtum bewahren, mußte er begründen, warum die deutsche Nation einen größeren Teil Europas bewohnte als ihn das Deutsche Reich einnahm. Er berief sich dazu auf die Kultur und die Sprache. „Die Kultur läßt sich aber nicht in politische Grenzen bannen, sondern ist ein Gemeingut der Völker und für diese giebt es, da sie im Verlaufe der verheerenden Stürme, die man Weltgeschichte nennt, bunt durcheinander geworfen und vermengt worden, gegenwärtig nur noch ein unterscheidendes Merkmal – die Sprache. Die Kultur eines Volkes reicht daher so weit, als seine Sprache erklingt, und die deutsche Kultur hat somit zu Grenzen ihres Gebietes nicht etwa diejenigen des deutschen Reiches, sondern umfaßt alle Bevölkerungen, deren traute Muttersprache unsere teure deutsche Zunge, ohne Ausschluß irgend einer ihrer Mundarten ist. Außerhalb der Grenzpfähle, welche das heutige offizielle Deutschland umstehen, berücksichtigt daher unser Buch namentlich auch das deutsche Österreich, die deutsche Schweiz und die holländisch-flämischen Niederlande, welche Länder einst alle zum deutschen Reiche gehörten und gelegentlich auch jene Gegenden außerhalb des geschichtlichen deutschen Gebietes, in welchen Stammes- und Sprachgenossen seit geraumer Zeit zahlreich leben, wie die deutschen Kolonien in Ungarn und Siebenbürgen, in den russischen Ostseeländern, im fernen überseeischen Amerika und Australien.“55
Der Begriff der Kultur, den Henne am Rhyn hatte, war weniger naturwissenschaftlich-technisch geprägt, sondern mehr auf eine möglichst weitgehende Harmonisierung der Volksgemeinschaft und ebenso möglichst weit verbreitete Bildung angelegt. Er zog sie daher für die Beschreibung der Kulturblüte seiner Zeit auch als Gradmesser heran: „Es hob sich zu Anfang der sechziger Jahre das Vereinswesen ungemessen. Nicht nur die (...) Arbeitervereine entstanden damals (...), auch Schützen-, Turn- und Gesangvereine nahmen desto mehr zu, je mehr sich das politische Leben freieren Zuständen näherte. Die (...) alle zwei oder drei Jahre abgehaltenen allgemeinen deutschen Schützenfeste nahmen wie auch die Turn- und Gesangfeste, einen wachsenden patriotischen Charakter an, ebenso die Wanderversammlungen wissenschaftlicher, wohlthätiger und anderer Vereine und die sich großartig entwickelnden, praktischer Nächstenliebe dienenden Feuerwehren. Schon 1861 bildete sich (...) der Protestantenverein mit dem Zwecke, die Religion mit der Wissenschaft zu versöhnen und dem Volke statt starrer Orthodoxie ein lebendigeres und zeitgemäßeres geistiges Brot zu bieten, als es bisher erhalten hatte. (...) Auf [S. 45] katholischer Seite sonderten sich in ähnlichem Streben die Altkatholiken von der römischen Kirche ab. (...) Ebenso hob sich der Buchhandel aufs neue (...) Die Encyclopädien des gesamten Wissens (...) vergrößerten ihren Umfang, Gehalt und Leserkreis.“56 Einen Schatten auf diese Idylle warfen lediglich die Sozialdemokraten, „deren Bestrebungen aber auf Vernichtung der Religion, des Staates, der Familie, der Wissenschaft und der Kunst hinzielen und deren eiserne Konsequenz das Faustrecht bildet“57, wie er in der von Erich Fromm weiter vorne beschrieben, kleinbürgerlichen Art unterstellte.
Das alles und alle verbindende Band dieser Kultur war die deutsche Sprache, die in vielen Teilen der Welt gesprochen wurde, jedem deutschsprachigen Leser und jeder deutschsprachigen Leserin das Gefühl gab, einer weltumspannenden Gemeinschaft anzugehören. Allerdings mußte Henne am Rhyn zugeben: „Die deutsche Kultur hat kein hohes Alter im Vergleich mit den Kulturen anderer Völker; ja es giebt unter den zivilisierten Völkerstämmen mit eigenartiger Kultur nur einen, dessen geistige Entwickelung jünger ist als die der Germanen, nämlich den der Slawen.“58 Ja, mehr noch. „Außerdem aber, daß die deutsche Kultur verhältnismäßig jung ist, erfreut sie sich so wenig voller Selbständigkeit als die Kulturen sämtlicher europäischer Völker, sondern beruht gleich allen diesen auf einer dreifachen Grundlage, nämlich erstens auf der griechisch-römischen Kultur, die aber wieder teilweise die orientalische Kultur, namentlich Ägyptens und Chaldäas, zur Grundlage hat, zweitens auf der christlichen Religion und erst in dritter Linie auf eigenartigen national-germanischen Elementen.“59 War die deutsche Kultur schon weder alt noch originär, so konnte sie doch auf eine durch Alter ehrwürdige Ahnenreihe zurückblicken.
Nach diesen eher wenig erfreulichen Mitteilungen ging Henne am Rhyn wieder zu Erfreulicherem über, indem er fortsetzte: Zum Troste des deutschen Selbstbewußtseins müssen wir jedoch hinzufügen, daß die deutsche Kultur, wenn sie auch vermöge der ersten beiden jener drei Grundlagen mit den Kulturen der übrigen seit dem Untergange des klassischen Altertums bestehenden europäischen Völkern ein Ganzes bildet, doch vor allen diesen einen bemerkenswerten Zug voraus hat, nämlich denjenigen einer unbefangenen, vorurteilslosen Würdigung und Anerkennung der Vorzüge und Verdienste aller übrigen Völker, einen Zug, den wir bei den letzteren vergebens suchen.60 Damit hatte Henne am Rhyn den Punkt erreicht, auf dem er dem deutschen Selbstbewußtsein zu einem Überlegenheitsgefühl über alle anderen Völker und Nationen verhelfen konnte. Wohlwollend und gerecht zu sein, ist ja tatsächlich eine erstrebenswerte Charaktereigenschaft, und mit ein bißchen Selbstgerechtigkeit konnte man sie ganz leicht an sich selbst und als nationale Eigenschaft entdecken. Doch Henne am Rhyn konnte seinen Leserinnen und Lesern, zwar verpackt in milden Tadel, der aber mittlerweile durch die geschichtliche Entwicklung ohne Mühe als überholt erkennbar war, noch weiteres Gutes vermelden: „Freilich steht diesem weitherzigen Zuge gerade bei den Deutschen ein solcher gegenüber, der das gerade Widerspiel zu demselben bildet, nämlich die zähe Anhänglichkeit an die engeren Kreise des Lebens, an die Gemeinde, die nähere Umgebung und den Stamm. Aber dieser ‚Partikularismus‘, wie man ihn genannt hat, muß als ein tief berechtigter anerkannt werden, und wenn er auch in Verbindung mit seinem Widerspiel, dem Kosmopolitismus, geraume Zeit den zwischen beiden die Mitte einnehmenden nationalen Patriotismus zurückdrängen konnte, so haben doch gewiß beide Extreme, das Hängen am Kleinen und das Verständnis für das Große, in ihrer Wechselwirkung dazu beigetragen, die goldene Mittelstraße, das Volks- und Vaterlandsgefühl, wenn auch etwas spät, doch um so entschiedener, gesunder und freier von krankhafter Selbstüberschätzung, wie man sie bei so manchen Völkern findet, und daher auch wohl für unabsehbar lange Zeit hervortreten lassen.“61 [S. 46]
In seinen weiteren einleitenden Ausführungen behandelte Henne am Rhyn dann auch noch die unter seinen Zeitgenossen heftig diskutierten Fragen, ob das deutsche Volk ureingeboren oder zugewandert sei, welche Bewandtnis es mit den Indogermanen und den Ariern hätte und dergleichen mehr, die er aber alle als belanglos abtat, weil die wissenschaftlichen Grundlagen für klare Aussagen noch unzureichend wären, um endlich zum Beginn der deutschen Kulturgeschichte zu gelangen: „Die erste zuverlässige Nachricht von unseren unzweifelhaften Vorfahren fällt mit deren erster bekannter Wanderung zusammen. Es ist die der Teutonen und Kimbrer. Das erste Volk, das älteste von germanischem Stamme, das in der Geschichte genannt wird, da es schon der Massaliote Pytheas62 zur Zeit Alexanders des Großen63 erwähnt, wohnte östlich von der unteren Elbe, etwa in Lauenburg, wahrscheinlich aber in einem größeren Gebiete, während die Kimbrer den Norden der Halbinsel Jütland einnahmen. (...) Mit ihnen aber wanderten die Ambronen, deren Name in der friesischen Insel Amrom fortleben dürfte. Diese Wanderung zu Ende des zweiten Jahrhunderts vor Chr. angetreten, war das Vorspiel der großen ‚Völkerwanderung‘ germanischer und anderer Stämme, und damit treten die Germanen, aus dem Dunkel heraus, das diese blonden und blauäugigen, im Norden seit unmeßbarer Zeit einheimischen Riesen bis dahin einhüllte; sie traten daraus hervor, gleich im Anfange die Welt mit Schrecken erfüllend, um dauernd auf der Weltbühne eine Rolle zu spielen, die sie bald tief demütigte bald wieder hoch zu Glanz und Macht emporhob. Dieser für ihr Schicksal entscheidende Augenblick ist daher wohl der richtige, ihre Geschichte mit der Schilderung ihrer Kulturzustände zu eröffnen (...)“+64.
In dieser Auffassung traf sich Henne am Rhyn mit dem österreichischen deutschnationalen Politiker Georg von Schönerer (1842-1921), der mit seinen Anhängern im Jahre 1887 zum Jahrestag der im Jahre 113 v. u. Z. geschlagenen Schlacht von Noreia – der Ort wird im österreichischen Bundesland Kärnten vermutet –, in der die Kimbern und Teutonen ein römisches Heer besiegten, die „Zweitausend-Jahr-Feier germanischer Geschichte“ festlich beging. „Vor dem rauhen, aber urkräftigen Kriegsgeschrei der Kimbern und Teutonen erbebten die starken Grundfesten des Römerreiches als erste Mahnung des Geschickes: ‚Platz den Germanen!‘“65 führte er in seiner Festrede aus. Am 24.6.1888 wurde von Schönerer in der Wachau in Niederösterreich feierlich das Jahr 2001 n. N. (= nach Noreia) begrüßt. Schönerer wollte mit dem Jahr der Schlacht von Noreia die neue Zeitrechnung für die deutsche Geschichte beginnen lassen. In demselben Geiste eröffnete auch Henne am Rhyn nach der Einleitung das Erste Buch seiner „Kulturgeschichte des deutschen Volkes“ mit der Kapitelüberschrift „Die ältesten Zustände der Deutschen“66, das im wesentlichen eine Nacherzählung der lobrednerischen „Germania“ des Publius Cornelius Tacitus enthält. Immerhin hatte er damit für die Deutschen eine zweitausendjährige Geschichte gewonnen, was selbst für eine noch junge Kultur, wie er einleitend festgestellt hatte, ein ansehnliches Alter darstellt.
Am Ende des zweiten Bandes kam Henne am Rhyn schließlich zur Abschlußbetrachtung: „Es ist die Aufgabe der politischen Geschichte, den Hergang der drei Kriege zu erzählen, in welchen die nun seit 1862 folgende starke Regierung unter Otto von Bismarck-Schönhausen67 ein neues Deutschland geschaffen hat. Durch den ersten derselben (1864) wurden die ‚meerumschlungenen stammverwandten‘ Herzogtümer im äußersten Norden deutscher Lande von der dänischen Fremdherrschaft befreit. Im zweiten (1866) ist der unhaltbare Dualismus in dem abgelebten ‚deutschen Bunde‘ gebrochen und statt einer eifersüchtigen Doppelherrschaft ein festes und treues Bündnis zweier gleich starken -unresolved- Reiche vorbereitet (seither auch abgeschlossen) worden. Der dritte Krieg endlich (1870 auf 1871), in welchem die deutsche Vaterlandsliebe [S. 47] noch einmal wie 1813 erwachte, hat das französische Kaiserreich auf dem Gipfel seines Eigendünkels und seiner Anmaßung niedergeworfen, den Rhein wieder zum deutschen Strome gemacht, wie er es von den Karolingern bis zum westfälischen Frieden war, und ein neues deutsches Reich geschaffen, dessen Spitze der Staat einnahm, dem sie nach Macht und Verdienst gebührte. Diese an das Wunderbare grenzenden Erfolge hat ein Heer geschaffen, das in seltener Tüchtigkeit und Kraft vom preußischen zum norddeutschen und endlich zum deutschen sich erweiterte und unter der Leitung des Schlachtenlenkers Moltke68 und eines glänzenden Stabes genialer Heerführer nicht nur Krieg führte, sondern auch Frieden schuf.“69 Mit dieser nur wenig verschleierten Lobrede auf den Krieg als Vater aller Dinge, vor allem aber als Vater der deutschen nationalstaatlichen Einigung, folgte Henne am Rhyn wie auch sieben Jahre später Reymond dem damaligen Geschichtsverständnis: Geschichte ist eine Abfolge von Kämpfen.
Beide bereiteten mit ihren Ausführungen aber auch den Boden, auf dem eine politische Propaganda wirksam werden konnte, die den Krieg als erlaubtes und unverzichtbares Mittel der Politik anpries. Als Beispiel sei auf die Broschüre „Österreichs Zusammenbruch und Wiederaufbau“, die in den Kreisen um Schönerer eifrig vertrieben wurde, hingewiesen. Als Kerngedanken wurden in dieser Broschüre niedergelegt: „Eine Fortsetzung des Krieges von 1866 wird dann unvermeidlich sein. Dann endlich müssen die Länder an der Donau von dem Fluch der Halbheit erlöst werden.“ – „Der Krieg ist die beste Grundlage zur Schaffung neuer staatlicher Formen. Das halbdeutsche Österreich muß zu einem ganzdeutschen Gliede des neuen deutschen Volksreiches werden. Preußen erhält Schlesien und Mähren. Sachsen erhält Böhmen, Bayern erhält das Innviertel und die Länder Salzburg, Vorarlberg und Tirol. Das Küstenland zusammen mit der Südspitze von Dalmatien, mit den Häfen Triest, Pola und Cattaro bildet ein deutsches Reichsland; (...) es bildet die Grundlage für die deutsche Seemacht in der Adria und dem Mittelmeer. Aus dem Rest, bestehend aus den Ländern Ober- und Niederösterreich, Steiermark, Kärnten und Krain, wird ein selbständiges Königreich Österreich oder Ostreich gebildet; es wählt sich einen König aus den nicht regierenden Fürstenhäusern Deutschlands.“70
Henne am Rhyn war derartigen militärischen Umstürzen eher abhold. Er wollte es mit den drei deutschen Einigungskriegen genug sein lassen und versuchte in weiterer Folge die außerhalb des Deutschen Reiches verbliebenen Deutschen mit diesem Verlauf der Geschichte zu versöhnen, indem er auch ihnen eine wichtige Aufgabe für die Weiterentwicklung der deutschen Kultur zuwies. „Die nicht mit dem Reiche vereinten, durch die geschichtliche Entwickelung auf eigene Wege gewiesenen deutschen Nachbarn und Sprachgenossen in Österreich und der Schweiz können durch rege Bethätigung an deutscher Wissenschaft, Dichtung und Kunst, durch warmen Sinn dafür, durch aufrichtige Freundschaft gegen ihre Stammesbrüder im Reiche, wie durch treue Pflege und Bewahrung der Denkmale ihres eigenen deutschen Volkstums an der nationalen Weiterbildung teilnehmen. Den bedrückten Deutschen in Ungarn und Rußland aber bleibt die Hoffnung auf die Zukunft, in welcher ihre Unterdrücker fallen können. Bildet ja das deutsche Sprachgebiet, auch über die diplomatischen Grenzen hinaus, eine Einheit in Wissenschaft und Literatur wie kein anderes, und stellt eine geistige Macht dar, mit der gerechnet werden muß.“71
Den Blick auf das Deutsche Kaiserreich gerichtet, fand Henne am Rhyn sogar tadelnde und warnende Worte: „Auf dem Gebiete der nationalen Maßhaltung bleibt dagegen im neuen Reiche noch manches zu wünschen. Von der Zukunft ist Vervollkommnung in dem richtigen Maße des Nationalbewußtseins zu hoffen. Eine Nachahmung des französischen Chauvinismus neben fortgesetzter Aufnahme der mehr als zweifelhaften Romane und Komödien [S. 48] des revanchesüchtigen Nachbarvolkes ist nicht der rechte Weg. Nur gerechte Würdigung der guten Charakterseiten und der tüchtigen Leistungen aller Nationen neben Hochhaltung und Wertschätzung der eigenen Horte des Wissens und Fühlens kann zum Heile führen. Die deutsche Kultur (...) ist reich genug, um sich nicht mit fremden Federn schmücken zu müssen. Man kann das Gute des Fremden schätzen, ohne ihr Schlechtes mitzunehmen, und wir besitzen selbst soviel Gutes, um elende Fremdware entbehren zu können.“72
Georg von Schönerer gab die Parole aus „Durch Reinheit zur Einheit“ und forderte die Wiederherstellung der Reinheit der deutschen Kultur und Ausmerzung alles Fremden, worunter er in erster Linie alles Jüdische verstand, während Henne am Rhyn zwar in gemäßigterem Ton, aber doch mit unüberhörbarer Erregung das gleiche verlangt, sich damit aber vor allem gegen die Einflüsse des welschen, im gegebenen Fall des französischen Wesens verwahrte. Sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen war der Begriff der Kultur unbewußt mit mythologischen Reinheitsvorstellungen verknüpft, die bei den Anhängern Schönerers zu deutlich beobachtbarem neurotischem Sektierertum im Streben nach der Bewahrung der Reinheit der deutschen Kultur führten.73 Henne am Rhyn widerlegte zumindest unbewußt und für seine Person die am Beginn seines Werkes die dem deutschen Wesen zugeschriebene vorurteilsfreie Weitherzigkeit gegenüber den Kulturen anderer Völker. Seine Leserinnen und Leser werden seine Botschaft wohl verstanden haben: Über die deutsche Kultur geht nichts oder, schärfer formuliert, Deutschland, Deutschland über alles.
Einige Worte über Ideologie
In den vorangegangenen Ausführungen war oft von Ideologie die Rede, ohne daß erklärt worden wäre, was mit diesem Begriff gemeint ist. Der Begriff der Ideologie ist im noch immer bestehenden Sprachgebrauch eine Hervorbringung des 19. Jahrhunderts, die mit den Namen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) und vor allem Karl Marx und Friedrich Engels verbunden ist. Von den beiden Letztgenannten stammen auch die als klassisch geltenden Formulierungen über das Wesen und die Entstehung der Ideologie: „Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich die herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, so daß ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Die herrschenden Gedanken sind weiter Nichts -unresolved- als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefaßten herrschenden materiellen Verhältnisse; also der Verhältnisse, die eben eine Klasse zur herrschenden machen, also die Gedanken ihrer Herrschaft. (...) Die Teilung der Arbeit, die wir schon oben als eine der Hauptmächte der bisherigen Geschichte vorfanden, äußert sich nun auch in der herrschenden Klasse als Teilung der geistigen und materiellen Arbeit, so daß innerhalb dieser Klasse der eine Teil als die Denker dieser Klasse auftritt (die aktiven konzeptiven Ideologen derselben, welche die Ausbildung der Illusion dieser Klasse über sich zu ihrem Hauptnahrungszweige machen), während die Andern sich zu diesen Gedanken und Illusionen mehr passiv und rezeptiv verhalten, weil sie in der Wirklichkeit die aktiven Mitglieder dieser Klasse sind und weniger Zeit dazu haben, sich Illusionen und Gedanken über sich selbst zu machen“74 Womit auch die Beziehung zwischen den Verfassern der in diesem Beitrag vorgestellten Werke und ihrem Publikum recht treffend beschrieben wäre. Die Leserinnen und Leser wollten in der Lektüre die moralische Rechtfertigung ihres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Handelns finden, [S. 49] die ihnen die Autoren auch gaben, indem sie die Welt so darstellten, als sei der bestehende Zustand das notwendige beziehungsweise gottgewollte Ergebnis der zurückliegenden geschichtlichen Entwicklung. Offen ist aber nach wie vor die Frage: Wie kommen diese Anschauungen in die Köpfe der Menschen hinein? Es ist wahrscheinlich kein Zufall, daß die Ideologie im 19. Jahrhundert zum philosophischen und gesellschaftswissenschaftlichen Begriff wurde und in dem Maße an Bedeutsamkeit für die Menschen und an Breitenwirkung gewann, wie der Glaube an das Dasein Gottes durch die wachsenden Kenntnisse der Wissenschaften geschwächt und aufgelöst wurde. Mit dem Sterben Gottes, der immer als Vater verstanden worden war und dem Heinrich Heine (1797-1856) einen ironischen Nachruf widmete,75 schwanden auch die väterlichen Dimensionen von Macht und Autorität und das narzißtische Streben nach einer mütterlichen, bergenden, harmonischen, hindernislosen Welt, die dem frühkindlichen Erleben des Einsseins von Mutter und Kind entspräche, gewann zusehends die Oberhand. Die Ideologie stellte den Menschen die Geborgenheit in einer von störenden Einflüssen befreiten Welt in Aussicht und wiegte sie auch in dem Glauben, daß dieser Zustand tatsächlich erreicht werden könnte. Sie schmeichelte somit den einer kindlichen Entwicklungsstufe zugehörigen, aber im Erwachsenenalter noch immer wirksamen narzißtischen Allmachtsphantasien der Menschen, sodaß Janine Chasseguet-Smirgel sie als eine Art „narzißtische Himmelfahrt“ bezeichnete.76
Nachdem nun schon einige Male das Wort „narzisstisch“ gebraucht worden ist, erscheint es angebracht, in Kürze zu erläutern, was unter Narzißmus zu verstehen ist und in welchem Zusammenhang er mit den vorliegenden Ausführungen steht.
Der Begriff „Narzissmus“ wurde im Jahre 1914 von Sigmund Freud geprägt77 und zur Bezeichnung einer übersteigerten Selbstliebe, die zu Lasten einer reifen Beziehungsfähigkeit geht, verwendet. So ist dieser Begriff in das allgemeine Verständnis und in den Sprachgebrauch eingegangen. Als Ergebnis der Säuglingsforschung – vertreten etwa durch Heinz Kohut oder Daniel Stern – der vergangenen zwei Jahrzehnte hat sich die Beurteilung des Narzißmus dahingehend gewandelt, daß er nun als Grundbaustein der menschlichen Beziehungsfähigkeit betrachtet wird. Um nämlich eine beziehungsfähige und harmonische Persönlichkeit aufbauen zu können, bedarf jeder Mensch von Kindheit an:
- einer Bezugsperson, die ihn annimmt und in seiner Persönlichkeit anerkennt und für die er auch etwas tun kann, wodurch sein Selbstwertgefühl Bestätigung und Stärkung findet,
- jemanden, die oder den er idealisieren kann, mit dem oder er sich eins fühlen kann und an dessen oder deren Vorbildlichkeit er seien Lebensvollzug ausrichten kann, wobei diese Vorbilder sowohl reale Personen – Freunde, Schlagerstars, Sportgrößen, Künstler und andere – als auch fiktive Gestalten – Comicsfiguren, Helden aus der Literatur, Religionsstifter – sein können,
- die Gelegenheit, sich als gleicher unter gleichen zu fühlen, weshalb er sich Cliquen, Vereinen, Parteien, Religionsgemeinschaften und dergleichen anschließt, um sich durch die Übereinstimmung mit anderen in seiner eigenen Persönlichkeit bestärkt zu fühlen.
Selbstverständlich bleibt dieses narzißtische Gefühl der Allharmonie nicht ungestört. Vielmehr erlebt der heranwachsende Mensch bereits in früher Kindheit empfindliche „narzißtische Kränkungen“, die er aber wegen seiner noch ungenügenden verstandesmäßigen Reife nur auf der Ebene des sogenannten primärprozeßhaften Denkens verarbeiten kann. Dieser psychische Primärprozeß läßt sich mit den Eigenschaften des
- bildhaften, nichtsprachlichen Denkens,
- zeitlich ungegliederten Denkens, dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowohl als Erfahrung als auch als Kategorien fremd sind, [S.
50]
- Denkens in Analogien und Symbolen
beschreiben.
Trotz der erlittenen Kränkungen ist der Narzißmus die stete Antriebskraft der Strebens „Eine Welt vorzufinden, in der es keine wesentliche Störung gibt, sondern Wohlbefinden, Ruhe, Harmonie, Spannungslosigkeit“78. Dieses fortdauernde Wirken des Narzißmus in jedem Menschen zeigt sich unter anderem auch darin, daß in den Mythen und Religionen der Völker in verschiedener Weise Vorstellungen eines Paradieses, eines Nirwanas, von Elysischen Gefilden oder eines Goldenen Zeitalters enthalten sind und Glauben finden. In stärker der Vernunft verbundenen Kulturepochen treibt der Narzißmus Wissenschafter und Philosophen dazu, Utopien und Ideologien zu entwerfen und zu entwickeln, die harmonische Lebens-, Gesellschafts- und Staatsformen zu Inhalt und Ziel haben.
Indem Ideologien die Orientierung des Lebens auf ein Ziel hin anbieten und auch den kindlich-menschlichen Geborgenheitswünschen durch die Einbindung des einzelnen in die Gemeinschaft derer, die an das gleiche Ziel glauben beziehungsweise dem gleichen Ziel zustreben, nachkommen, erfüllen sie die gleiche Aufgabe im Seelenhaushalt, die auch der Religion zukommt. Ideologien sind daher nichts anderes als säkularisierte, verweltlichte Religionen. Daraus erklärt sich auch ihr vielfältiges Auftreten, nachdem die aufklärerische Kritik die Bindungskräfte der Religion erheblich geschwächt hatte.
Es lassen sich zwei Grundmuster beobachten, nach denen Ideologien aufgebaut sein können – den Individualismus und den Kollektivismus.
Individualistische Ideologien
Der Individualismus ist bestrebt, die unheimliche Einsamkeit des Menschen in der Welt nach dem Tod Gottes zu seiner eigentlichen Größe hochzustilisieren, sodaß der Mensch zuletzt monadenhaft, losgelöst von allem – also absolut in der eigentlichen Bedeutung des Wortes – nur mehr sich selbst gegenübersteht. In individualistischen Ideologien strebt der Mensch für sich nach einer nicht in die Welt einbezogenen, also sozusagen gottgleichen Gestalt seines Seins, mit der er in seiner Einsamkeit Umgang pflegen kann.
Einer der berühmtesten Vertreter dieser individualistischen Ideologie im 19. Jahrhundert war der dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813-1855), der auf ein bürgerliches Gelehrtenleben verzichtete, „um eine Aufgabe zu erfüllen, die ihm“, wie er meinte, „auferlegt war, ihm allein unter Millionen Menschen, als einem von den zwei oder drei Ausnahmemenschen in jeder Generation, ‚die in schrecklichem Leiden entdecken sollen, was den anderen zugute kommt.‘“79 Kierkegaard fühlte sich, wie manche andere seiner Zeitgenossen auch, als Übermensch, der nicht mit den herkömmlichen Maßstäben der bürgerlichen Welt gemessen werden konnte. Die Ideologie des Übermenschen sollte im 20. Jahrhundert noch verderbliche Früchte zeitigen.
Kollektivistische Ideologien
Individualistische Ideologien sind Schöpfungen des intellektuellen Heroismus, die auf Dauer keine Anhängerschaft gewinnen können. In der geschichtlichen Wirksamkeit nachhaltiger und tiefergreifender sind und waren darum die kollektivistischen Ideologien.
Den zentralen Bezugspunkt dieser Ideologien bildet die Zugehörigkeit zu einer bevorzugten Rasse oder zu einer mit einer weltgeschichtlichen Sendung betrauten Klasse, aus der heraus für den einzelnen oder die einzelne Sicherheit und Sinnhaftigkeit des Lebens fließen. Ihren Ausdruck finden kollektivistische Ideologien in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen, Kirchen, Sekten und vergleichbaren Gruppen, die alle von sich elitäre Selbstbilder pflegen. Entweder sind diese Gruppen groß und stark, dann schöpfen sie daraus ihr Selbstwertgefühl, [S. 51] oder sie sind zwar klein, aber im Besitz eines geheimen Wissens oder der Wahrheit schlechthin, sodaß sie daraus ihre Überlegenheitsgefühle gegenüber der „misera plebs“, dem gemeinen Volk speisen.
Eingebunden in derartige Organisationen überantwortet das einzelne Mitglied seine persönliche Eigenständigkeit und auch die persönliche Verantwortlichkeit für sein Tun und Lassen einer über ihm stehenden Autorität, von der es als Ausgleich für die Aufopferung seiner Individualität eine Gruppenidentität zurückbekommt, die ihm wegen seiner Aufgehobenheit im gleichsam lebensbekleidenden Uterus der großen Gemeinschaft Sicherheit und Stärke verleiht. Ein Mensch, der sich einer kollektivistischen Ideologie anheim gegeben hat, „fühlt sich (...) stark, wenn er sich der Autorität unterwerfen kann, wobei die Autorität (...) aufgebläht und vergöttlicht wird und er zugleich sich selbst aufbauscht, indem er sich jene, die seiner Autorität unterworfen sind, einverleibt. Es handelt sich um einen Zustand sadomasochistischer Symbiose, die ihm das Gefühl von Stärke und Identität verleiht. Weil er ein Teil des ‚Großen‘ (was immer das sein mag) ist, wird er selbst groß; wäre er allein, auf sich gestellt, so würde er zu einem Nichts zusammenschrumpfen.“80 Darum wird ein solcher Mensch einen Angriff auf die von ihm verehrte Autorität als einen Angriff auf sich selbst empfinden, den es mit allen Mitteln abzuwehren gilt. Es ist darum eine gefährliche Täuschung, kollektivistische Ideologien als Grundpfeiler der Demokratie zu sehen. Wie die Geschichte zeigt, war das Kollektiv vielmehr immer wieder Wegbereiter des politischen Extremismus und Totalitarismus.
Das Kollektiv bedarf eines Führers als der Personifizierung der Autorität. Darum besteht auch keine Unvereinbarkeit zwischen kollektivistischen Ideologien und Führerdiktaturen. Ganz im Gegenteil, beide bedürfen einander, denn in der Führerpersönlichkeit finden die Ich-Ideale der Mitglieder einer Gruppe ihre Erfüllung und Verkörperung. Unbewußt zwar, aber nichtsdestoweniger wird die Führerpersönlichkeit von den sich ihr Unterordnenden als mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattete Vaterfigur gesehen. Tiefenpsychologische Forschungen haben ergeben, „daß jeder, zu dem man als Älterem, als einem in der Position überlegener Weisheit, Autorität oder Fähigkeit Befindlichem aufblickt, unbewußt eine Elternfigur darstellt. (...) Der Präsident einer Republik wird unbewußt genauso als Vater betrachtet – wie Gott oder ein Diktator oder ein von Gott gesalbter König oder ein kaiserlicher Halbgott als Vater gilt.“81 Diese Führerpersönlichkeit wird als magischer Helfer gesehen, von dem man erwartet, daß er einem verschafft, was man vom Leben erhofft. „Die Gründe, weshalb jemand an einen magischen Helfer gebunden ist, sind (...) Unfähigkeit, allein zu sein und die eigene individuelle Persönlichkeit voll zum Ausdruck zu bringen (...) Die Intensität der Bezogenheit auf den magischen Helfer steht im umgekehrten Verhältnis zur Fähigkeit, die eigenen intellektuellen, emotionalen und sinnlichen Möglichkeiten spontan zum Ausdruck zu bringen.“82
Um es gerade heraus zu sagen: Kollektivistische Ideologien sind Erscheinungsformen einer ins Erwachsenenalter mitgenommenen kindlichen Unreife. Auf die Situation der Menschen des 19. Jahrhunderts angewandt heißt das, daß sie, nachdem sie von ihrem sowohl gefürchteten, wegen seiner Macht und Herrlichkeit aber auch geliebten und bewunderten und seiner Beschützerfunktion wegen auch ersehnten Vater-Gott verlassen worden waren, in den Schoß von Mutter-Rasse oder Mutter-Nation oder auch Mutter-Wissenschaft – darum auch die reichliche Verwendung von Frauengestalten als Sinnbilder für Völker, Staaten oder Wissenschaften in der Kunst des 19. Jahrhunderts – flüchteten in der Hoffnung, auf diese Weise wieder in das Paradies der noch ungestörten Zweifaltigkeit von Mutter und Kind zurückkehren zu können. [S. 52]
Der Held – ein Muttersöhnchen
Hieraus erklärt sich auch die Freude der Menschen des 19. Jahrhunderts an Waffengeklirr und Heldenpose. Diese Feststellung mag im ersten Augenblick als Widerspruch zu dem soeben Gesagten erscheinen, denn viel eher würde man von einer Kultur, hinter der als unbewußte Triebkraft der Wunsch nach der Rückkehr in den Mutterschoß steht, eine gewisse Verweichlichung und Verweiblichung erwarten.
Das wäre jedoch zu kurzschlüssig gedacht. Zur Erklärung muß noch einmal auf das Verschwinden des Vater-Gottes zurückgekommen werden. Dieses Verschwinden hinterließ eine schmerzliche, angsterweckende Leere im Seelenhaushalt der Menschen. Sie fühlten sich verlassen und gekränkt und wollten sich an dem verschwundenen Vater rächen – darum auch der heftige Antiklerikalismus und die glühende Religionsfeindlichkeit in den gebildeten Kreisen, die den Verlust des Vater-Gottes am stärksten spürten. Aus dem Wunsch nach Rache erwächst nun die Gestalt des Helden. Der Held will für die Verwundung seiner Seele Rache nehmen, das heißt, er will Vergeltung oder genauer gesagt, er will die Verwundung durch die Vergeltung wieder ungeschehen machen, was aber unmöglich ist. Die Tragik des Helden liegt nun darin, daß er trotzdem versucht, über den Weg der Rache den Zustand der Unversehrtheit wieder zu gewinnen. „Das vornehmste Ziel des Helden ist die Heilung“, umreißt Bernd Nitzschke die wesentlichen Merkmale eines Heldenlebens, „die allerdings gegen die Einsicht in die Unmöglichkeit einer Wiederherstellung der vortraumatischen Unverletztheit erreicht werden soll. Der Held besteht vielmehr auf der Verwirklichung seiner wunscherfüllenden Phantasien. Das heißt, der Held will nicht Heilung, er will das Heil. Er will keine Verzeihung, er will Erlösung. Also darf der Held auch kein Mensch bleiben, der seine Endlichkeit und Verletzlichkeit akzeptiert. Er muß vielmehr zum Übermenschen, zum Illusionisten werden, dem es scheinbar gelingt, die Realität zu korrigieren.“83 Wie Otto Rank in seiner Studie über Heldenmythen84 anhand zahlreicher mythischer Heldenbiographien vorgeführt hat, enden diese Versuche, die Wirklichkeit zu überwinden, für die Helden immer tödlich. Alle haben sie eine „Achillesferse“, eine verwundbare Stelle, die immer schwärende Wunde ihres gekränkten Narzißmus, an der sie schlußendlich zugrunde gehen.
Im Tod des Helden kommt auch die unbewußte erotisch-inzestuöse Seite eines Heldenlebens zum Vorschein. Der Held kämpft gegen die bösen – das heißt väterlichen, feindlichen, angsteinflößenden – Mächte zur Rettung und Gewinnung einer Frau, einer reinen, einer hohen Frau, also einer Jungfrau und Mutter zugleich. Das mit dem Sieg über diese Mächte verbundene scheiternde Sterben des Helden in den Armen der errungenen Frau – die eben zugleich als Geliebte und Mutter gesehen werden muß – ist auch die phantastische Erfüllung der Sehnsucht nach der ursprünglichen, heilen Einheit mit der Mutter. In Wahrheit will der Held also gar nicht an die Stelle des Vaters treten, sondern immer nur Sohn bleiben, wie es der norwegische Dichter Henrik Ibsen (1828-1906) in den Schlußsätzen seines Dramas „Peer Gynt“ zum Ausdruck gebracht hat, wo der heimkehrende Held Peer Gynt seiner Geliebten Solveig mit den Worten in den Schoß sinkt: „Meine Mutter, meine Gattin; Weib, rein im Minnen! – O birg mich, birg mich da drinnen!“85
In die Heldenmythologien verwoben ist in geringerem oder stärkerem Ausmaß auch der manichäische Mythos des Kampfes zwischen Licht und Finsternis, zwischen Reinheit und Unreinheit. In den nationalistischen Ideologien erscheint die Mutter-Geliebte-Nation als immer wieder von bösen Feinden bedroht, die ihr durch Vermischung mit ihr ihre Reinheit rauben wollen, sodaß ihre Helden-Söhne-Geliebten aufgerufen sind, für sie in den Kampf zu ziehen. „Dulce et decorum est pro patria mori“.86[S. 53]
Epilog
Am 28.6.1914 stand an der Ecke Appelkai – Franz-Joseph-Straße in Sarajewo inmitten der Menschenmenge am Straßenrand der serbische Student Gavrilo Princip (1894-1918) und wartete wie diese darauf, daß der Autokonvoi mit dem Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand (1863-1914) vorbeikäme. Gegen dreiviertel elf Uhr kamen die Wagen tatsächlich. An der Ecke stockte die Fahrzeugkolonne, weil einer der Chauffeure irrtümlich abgebogen ist und dann wieder auf die richtige Strecke zurückkommen wollte. Gavrilo Princip erkannte sofort die einmalige Gunst des Augenblicks, zog seine Waffe und schoß zweimal aus kurzer Entfernung auf den Erzherzog-Thronfolger. Er traf diesen und seine Gattin Sophie Gräfin Chotek, Herzogin von Hohenberg, tödlich.87 Damit hatte er, der jugendliche Held, den bösen Feind getroffen, der die reine serbische Nation unterdrückt und befleckt hatte. Damit hatte er aber auch den auf der anderen Seite bestehenden Argwohn als berechtigt erwiesen: „Immer höher lodert der Haß gegen mich und mein Haus empor, immer unverhüllter tritt das Streben zutage, untrennbare Gebiete Österreich-Ungarns gewaltsam loszureißen.“88 Die Stunde der Helden-Söhne war gekommen. Auch Männer wie Strässle, Reymond oder Henne am Rhyn hatten sie darauf vorbereitet. [S. 54]
Anmerkungen:
1 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. In: Adolf Frisé (Hrsg.), Robert Musil, Gesammelte Werke. Bd. 1, Reinbek bei Hamburg 1987 (1930), S. 55.
2 Sigmund Freud, Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse (1917). In: Sigmund Freud, Gesammelte Werke. Bd. 12, S. 8. Freud nennt in dieser Schrift drei Kränkungen des menschlichen Narzißmus, nämlich die „kosmologische Kränkung“ durch Nikolaus Kopernikus (eigentlicher Name Koppernigk, 1473-1543), der die Annahme widerlegte, die Erde stünde im Mittelpunkt des Weltalls, sodann die soeben genannten „biologische Kränkung“ durch Charles Darwin (1809-1882) und zuletzt die „psychologische Kränkung“ durch die Psychoanalyse, die dem Menschen vor Augen führt, daß sein „Ich nicht einmal Herr im eigenen Haus“ ist.
3 Der Name Neandertal rührt von Joachim Neumann (1650-1680), einem Kirchenlieddichter, her, welcher sich gräzisierend Neander genannt und die romantische Schönheit dieses Tales gepriesen hatte.
4 Allerdings wurden bereits im Jahr 1832 bei Engis in Belgien und im Jahr 1848 auf Gibraltar Schädelreste geborgen, denen aber noch von der Fachwissenschaft die Anerkennung als Zeugnisse für das Dasein vormenschlicher Formen versagt geblieben ist.
5 Um eine Vorstellung über den Wissensstand des 19. Jahrhunderts über die Erdgeschichte zu geben, sei erwähnt, daß damals das wachsende Interesse an der Geologie zu zahllosen Funden von Fossilien ausgestorbener Tiere sowohl des Tertiärs als auch des Mesozoikums (ca. 225-ca. 70 Mio. Jahre v.u.Z.) führte, die ihrerseits zu immer neuen Mutmaßungen über ihre Herkunft und über ihre Lebens- und Todesumstände Anstoß gaben.
6 Mit Tertiär wird eine Epoche der Erdgeschichte bezeichnet, die vor 60 bis 70 Millionen Jahren begann und vor rund 2 Millionen Jahren endete.
7 Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes. Bd. 1., Berlin 1886, S. 8.
8 Das Tier. Die große internationale Zeitschrift für Tier, Mensch und Natur, 1998, H. 8, S. 71.
9 Siehe dazu Anton Szanya, „Sie ist das Opium des Volkes“. Tiefenpsychologische Aspekte der Religiosität. In: der freidenker 1995, H. 2, 8ff. und H. 3, S. 8ff.
10 Leszek Kolakowski, Die Gegenwärtigkeit des Mythos, München-Zürich 1972, S. 104.
11 Otto Henne am Rhyn (1828-1914), Journalist und Historiker, nach dem Studium Lehrer für Geschichte und Geographie, 1857-1859 Lehrer in St. Gallen, später Verwaltungsbeamter und Kantonsarchivar, 1872-1879 Herausgeber der „Freimaurerzeitung“ in Leipzig, ab 1879 Herausgeber der „Neuen Zürcher Zeitung“. Verfasser großangelegter kulturgeschichtlicher Werke in Gegenposition zu den politik- und militärgeschichtlichen Schwerpunkten der deutschen Geschichtsschreibung seiner Zeit. (Gekürzte Wiedergabe des Artikels „Henne am Rhyn“ In: The New Encyclopedia Britannica, 1998, Bd. 5, S. 832.)
12 Franz Sträßle, Illustrierte Naturgeschichte der drei Reiche, 4. Aufl., Stuttgart 1888, S. VI.
13 Ebd., S. 51.
14 Ebd., S. 52.
15 Genesis 9,1, „crescite et multiplicamini et implete terram et terror vester ac tremor sit super cuncta animalia terrae (...)„ („Wachset und vermehret euch und füllt die Erde und Furcht vor euch und Schrecken sei über allen Tieren der Erde.“)
16 Franz Sträßle, Illustrierte Naturgeschichte, a.a.O., S. 53. Die Verfasser folgten damit dem Rassengliederungsschema von Johann Friedrich Blumenbach (1752-1842), der fünf Menschenrassen unterschied, die sich durch Umwelteinwirkungen aus einer ursprünglichen Stammform herausentwickelt hätten.
17 Ebd., S. 53-56. Hervorhebungen im Original.
18 F. von Luschan, Rassen und Völker. In, J. von Pflugk-Harttung, Weltgeschichte; Die Entwicklung der Menschheit in Staat und Gesellschaft, in Kultur und Geistesleben. Bd. 1 „Altertum“, Berlin 1910, S. 42.
19 Mario Erdheim, Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit; eine Einführung in den ethnopsychoanalytischen Prozeß, 4. Aufl., Frankfurt am Main 1992 (1984), S. 411.
20 Das griechische Wort kosmos bedeutet soviel wie Ordnung oder Schönheit
21 D.i. Stufenleiter der Natur.
22 George L. Mosse, Die Geschichte des Rassismus in Europa, Frankfurt am Main 1990 (engl. Orig. 1985), S. 30f.
23 Der Begriff „Manichäismus“ geht auf den iranischen Religionsgründer Mani (216-276/277) zurück, der eine Heilsgeschichte entwarf, die vom Kampf des lichten Geistes gegen die dunkle finstere Materie geprägt ist; dieses theologische Heilsgeschichtsbild prägte seither alle christlichen Erneuerungsbewegungen Europas.
24 Die „schwarze“ Pädagogik – diese Farbgebung ist nicht zufällig – schreckt die Kinder auch mit der Gestalt des „schwarzen Mannes“.
25 Zitiert in Marvin Harris, Menschen. Wie wir wurden, was wir sind, München 1996 (engl. Orig. 1977), S. 113.
26 F. von Luschan, Rassen und Völker, a.a.O., S. 47.
27 Franz Sträßle, Illustrierte Naturgeschichte, a.a.O., S. 696.
28 Nach dem Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) und dem Mathematiker und Astronomen Pierre Simon de Laplace (1749-1827) benannte Hypothese der Entstehung des Sonnensystems, die mit den Worten von Strässle und Baur „von der Voraussetzung ausgeht, daß in der grauen Urzeit die Sinne und sämtliche Planeten, die um sie kreisen, einen ungeheuren, glühenden Gasball von sehr hoher Temperatur gebildet haben, dessen Durchmesser weit über die Bahn des Neptun hinausreichte. Diese kolossale Kugel war in beständiger Umdrehung um sich selbst und zugleich in einer Zusammenziehung auf kleineren Raum unter gleichzeitiger Aussendung von Licht und Wärme begriffen. Infolgedessen mußte die Umdrehungsgeschwindigkeit der Dunstmasse zunehmen; die Folge hiervon war die Abplattung des Gasballs an den Polen und die gleichzeitige Vermehrung der Zentrifugalkraft am Äquator. Sobald letztere eine gewisse Grenze überschritten hatte, mußte sich von der Dunstmasse in der Äquatorebene ein konzentrischer Ring ablösen, der später an seiner schwächsten Stelle zerriß und dessen Masse sich nun zu einer die innere Masse umkreisenden und zugleich um ihre eigene Achse sich drehender Kugel zusammenballte. So entstand der erste, äußerste Planet, und in gleicher Weise bildeten sich die übrigen Planeten und als Letzter Rest der gesamten Gasmasse die Sonne.“ (Sträßle, Illustrierte Naturgeschichte, a.a.O., S. 697.)
29 Sträßle, Illustrierte Naturgeschichte, a.a.O., S. 719.
30 Tatsächlich wurde erst im Jahre 1953 und 1954 mit den Experimenten von Stanley Lloyd Miller (geboren 1930; derzeit Professor an der University of California, San Diego; freundliche Mitteilung von Kyra Calhoun via alumni_gateway@development.uchicago.edu vom 19.8.1998) an der University of Chicago ein Lösungsansatz für dieses Rätsel gefunden. (Heinrich K. Erben, Die Entwicklung des Lebens. Spielregeln der Evolution, 3. Aufl., München-Zürich 1988, S. 78).
31 Sträßle, Illustrierte Naturgeschichte, a.a.O., S. 738.
32 M. Reymond, Weltgeschichte, Bd. 1. Neudamm 1893, S. 2f.
33 Ebd., S. 3.
34 Ebd., 8.
35 Ebd., S. 6.
36 Ebd, S. 7.
37 Ebd., S. 8.
38 Erich Fromm, Die Furcht vor der Freiheit, Frankfurt am Main 1987 (engl. Orig. 1941), S. 86.
39 Ebd., S. 86f.
40 M. Reymond, Weltgeschichte, a.a.O., S. 26 f.
41 Ebd., S. 76. Samuel Huntington ist also mit seiner modernen These vom Kulturkampf gar nicht so originell. Siehe: Samuel Huntington, Kampf der Kulturen. die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München-Wien 1996.
42 M. Reymond, Weltgeschichte, a.a.O., S. 57-59.
43 Ebd., S. 68.
44 Ebd., S. 69.
45 Ebd., S. 72.
46 Ebd., S. 76.
47 Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der kommunistischen Partei (1848). In: Iring Fetscher (Hrsg.), Karl Marx/Friedrich Engels, Studienausgabe in 4 Bden, Bd 3 „Geschichte und Politik“ 1, Frankfurt am Main 1976, S. 59.
48 Friedrich Heer, Der Glaube des Adolf Hitler. Anatomie einer politischen Religiosität, Frankfurt am Main-Berlin 1989 (1968), S. 69.
49 Felix Dahn (1834-1912), Professor für deutsche Rechtsgeschichte in München (1862/63), Würzburg (1863-1872), Königsberg (1872-1888) und Breslau (1888-1910), schrieb seine historischen Romane, Dramen und Novellen in „volksbildnerischer“ Absicht und gilt als einer der herausragenden Vertreter des „Professorenromans“, einer literarischen Gattung von dichterisch veranlagten Professoren verfaßten historischen Romanen, „in denen die angeblich historisch getreue Darstellung von Leben und Sitten der Vergangenheit oder fremder Kulturen die eigentl-unresolved- oft unwahrscheinliche, überspannt wirkende Handlung überwiegt und Gelehrsamkeit die dichterische Gestaltung zurückdrängt“. (Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, 5. Aufl., Stuttgart 1969, S. 593, Stichwort „Professorenroman“.)
50 Guido List, Carnuntum. Historischer Roman aus dem 4. Jhd. n. Chr., 2 Bde., Berlin 1889
51 Guido List, Pipara, die Germanin im Cäsarenpurpur. Historischer Roman aus dem 3. Jhd. n. Chr., 2 Bde, Leipzig 1895.
52 Theodor Mommsen, Römische Geschichte. 5 Bde. Berlin 1854-1856 und 1885. (Bd. 4 nie erschienen.)
53 Theodor Mommsen, Römische Geschichte. Bd 5 „Die Provinzen von Caesar bis Diocletian“, Berlin 1886, S. 130.
54 Ebd., S. 147f.
55 Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte, a.a.O., Bd. 1., S. 1. (Hervorhebungen im Original.)
56 Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte, a.a.O., Bd. 2., S. 397.
57 Ebd., S. 396.
58 Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte, a.a.O., Bd. 1., S. 1.
59 Ebd.
60 Ebd.
61 Ebd., S. 1 f.
62 Pytheas aus Massalia (heute Marseille) unternahm im Jahre 325 v.u.Z. eine Forschungsreise, die ihn von Gadira (heute Cádiz) nach Britannien, vielleicht auch zu Inseln nördlich davon, und zur Elbemündung führte. Sein Bericht ist in Bruchstücken erhalten.
63 Alexander III. (356-323 v.u.Z.; seit 336 König von Makdeonien)
64 Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte, a.a.O., Bd. 1., S. 13.
65 Zit. nach. Brigitte Hamann, Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators, München-Zürich 1996, S. 350.
66 Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte, a.a.O., Bd. 1., S. 14.
67 Otto von Bismarck (1815-1898; preußischer Ministerpräsident, ab 1862, deutscher Reichskanzler 1871-1890)
68 Helmuth von Moltke (1800-1891; 1857-1888 Chef des Großen Generalstabes).
69 Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte, a.a.O., Bd. 2., S. 397 f.
70 Zit. nach: Friedrich Heer, Der Glaube des Adolf Hitler, a.a.O., S. 75 f.
71 Otto Henne am Rhyn, Kulturgeschichte, a.a.O., Bd. 2., S. 398.
72 Ebd., S. 398.
73 Näheres dazu in Brigitte Hamann, Hitlers Wien, a.a.O., S. 347-351.
74 Karl Marx/Friedrich Engels, Feuerbach. 1. Teil der „Deutschen Ideologie“ (1845/46). In: Iring Fetscher (Hrsg.), Karl Marx, Friedrich Engels; Studienausgabe in 4 Bden., Bd. 1 „Philosophie“, Frankfurt am Main, 1971, S. 110.
75 „Unsere Brust ist voll von entsetzlichem Mitleid – es ist der alte Jehova selber, der sich zum Tode bereitet. Wir haben ihn so gut gekannt, von seiner Wiege an, in Ägypten, als er unter göttlichen Kälbern, Krokodilen, heiligen Zwiebeln, Ibissen und Katzen erzogen wurde. Wir haben ihn gesehen, wie er diesen Gespielen seiner Kindheit und den Obelisken und den Sphinxen seines heimatlichen Niltales ade sagte und in Palästina, bei einem armen Hirtenvölkchen, ein kleiner Gottkönig wurde und in einem eigenen Tempelpalast wohnte. Wir sahen ihn späterhin, wie er mit der assyrisch-babylonischen Zivilisation in Berührung kam und seine allzu menschlichen Leidenschaften ablegte, nicht mehr lauter Zorn und Rache spie, wenigstens nicht mehr wegen jeder Lumperei gleich donnerte. Wir sahen ihn auswandern nach Rom, der Hauptstadt, wo er aller Nationalvorurteile entsagte und die himmlische Gleichheit aller Völker proklamierte und mit solchen schönen Phrasen gegen den alten Jupiter Opposition bildete und so lange intrigierte, bis er zur Herrschaft gelangte und vom Kapitole herab die Stadt und die Welt, urbem et orbem, regierte. Wir sahen, wie er sich noch mehr vergeistigte, wie er sanftselig wimmerte, wie er ein liebevoller Vater wurde, ein allgemeiner Menschenfreund, ein Weltbeglücker, ein Philanthrop – es konnte ihm alles nichts helfen. Hört ihr das Glöckchen klingeln? Kniet nieder. Man bringt die Sakramente einem sterbenden Gotte.“ (Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. In: Heinrich Heine, Sämtliche Schriften in 12 Bden., Bd. 5 „Schriften 1831-1837“, Frankfurt am Main 1981, S. 590f.)
76 Janine Chasseguet-Smirgel, Zwei Bäume im Garten, Zur psychischen Bedeutung der Vater- und Mutterbilder, Wien 1988, S. 18.
77 Sigmund Freud, Zur Einführung des Narzißmus (1914). In: Sigmund Freud, Studienausgabe. Bd. 3, Frankfurt am Main 1982.
78 Sigrun Roßmanith, Religion als Forschungsgegenstand der Tiefenpsychologie. In: der freidenker, 1991, H. 3, S. 7.
79 Hans Joachim Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Bd. 2, Frankfurt am Main 1973, S. 188.
80 Erich Fromm, Der revolutionäre Charakter (1963). In: Erich Fromm, Das Christusdogma und andere Essays, München 1984, S. 120f.
81 Charles Brenner, Grundzüge der Psychoanalyse, Frankfurt am Main 1976 (1955), S. 196.
82 Erich Fromm, Die Furcht vor der Freiheit, a.a.O., S. 154.
83 Bernd Nitzschke, Männerhelden, die einsamen Rächer. Über das Verhängnis, sein eigener Vater werden zu wollen und dabei zu scheitern. In: Anton Szanya (Hrsg.), Elektra und Ödipus. Zwischen Penisneid und Kastrationsangst, Wien 1995, S. 124. (Hervorhebung im Original.)
84 Otto Rank, Der Mythus von der Geburt des Helden. Versuch einer psychologischen Mythendeutung, Leipzig-Wien 1909.
85 Henrik Ibsen, Peer Gynt. Ein dramatisches Gedicht. Schluß des 5. Aktes.
86 „Süß und ehrenvoll ist es, für das Verland zu sterben.“ [Quintus Horatius Flaccus (65-8 v.u.Z.)]
87 Die Darstellung des Attentats folgt Hellmut Andics, Der Untergang der Donaumonarchie. Österreich von der Jahrhundertwende bis zum November 1918 (= Österreich 1804-1975. Österreichische Geschichte von der Gründung des Kaiserstaates bis zur Gegenwart in vier Bänden, Bd 2.) Wien-München-Zürich 1974, S. 84-86.
88 Aus dem Manifest „An meine Völker!“ von Kaiser Franz Joseph (1830-1916, Kaiser seit 1848). In: Georg Wagner (Hrsg.), Österreich. Von der Staatsidee zum Nationalbewusstsein, Wien 1982, Abb. 33b (S. 611).
(Wortwahl, Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung entsprechen dem Original. Die im Original durch Sperrung hervorgehobenen Wörter wurden kursiv gesetzt. In eckiger Klammer steht die Zahl der jeweiligen Seite des Originaltextes. Offensichtliche Druckfehler wurden berichtigt.)