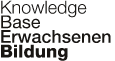„Eine stille Großtat”. Eugenie Schwarzwald zum 25jährigen Jubiläum der Volkshochschule Volksheim Ottakring 1925. Nachdruck aus der Neuen Freien Presse vom 21. Februar 1925
Full display of title
| Author/Authoress: | Schwarzwald, Eugenie |
|---|---|
| Title: | „Eine stille Großtat”. Eugenie Schwarzwald zum 25jährigen Jubiläum der Volkshochschule Volksheim Ottakring 1925. Nachdruck aus der Neuen Freien Presse vom 21. Februar 1925 |
| Year: | 1925 |
| Source: | Reprint in: Spurensuche. Zeitschrift für Geschichte der Erwachsenenbildung und Wissenschaftspopularisierung, 9. Jg., 1998, H. 3/4, S. 61-64. |
Es ist Wiener Art, von den Dingen, die einem am meisten am Herzen liegen, am wenigsten zu sprechen. So und nur so erklärt es sich, daß es um das "Volksheim" herum so still ist. Eine Einrichtung, der Hunderttausende von Menschen Wissen, Kunst, Freundschaft und Freude verdanken, müßte sonst ganz anders ins Bewußtsein der Gesamtheit gedrungen sein.
Aber das mag auch daher kommen, daß die Menschen, die in Wien etwas Ordentliches machen, sich einer ganz besonderen Zurückhaltung befleißen. Da liegt vor mir ein winziges Heftchen, dreißig Druckseiten, und erzählt bescheiden, beinahe kleinlaut von einer Großtat. Aufgerichtet in der schnöden Gedankenlosigkeit der Vorkriegszeit, aufrechterhalten in den blutigen Greueln des Krieges und nunmehr fortgeführt, unbeirrt durch die moralische Pestilenz der Nachkriegszeit.
Man liest und erkennt wieder einmal, daß menschliche Seelenkraft alles vermag. Der tiefgründige und gefühlsreiche Denker Stöhr1 spricht ein Wort aus, der aktive, von glühendem Gerechtigkeitsgefühl und wirklicher Menschenliebe erfüllte Organisator Hartmann2 läßt es zur Tat werden, und schon sind Hunderte da zu lehren und Tausende zu lernen. Was man sonst für das Wichtigste hält, das Geld, ist nicht wichtig. Man bemüht sich, nur wenig davon zu brauchen, und das treibt man dann auf: bittend, ermahnend, fordernd. Man ruft Gewissen wach und allmählich werden einige Besitzende so zur Pflicht erzogen, daß sie im Testament das "Volksheim" zu ihrem Erben einsetzen. Solches Geld bringt Segen. Jedenfalls hat kein amerikanischer Multimillionär mit seinen Dollars so viel ausgerichtet wie Ludo Hartmann mit ein paar tausend Friedenskronen. Es entstand eine wirkliche Volkshochschule, die sich komischerweise "Volksheim" nennen mußte, weil um die Zeit ihrer Entstehung die Dummheit in Österreich so groß war, daß sie sogar vor der Namengebung nicht halt machte. Aber "Heim" ist ja schöner als "Schule" und so ist das "Volksheim" die berühmteste Volkshochschule Europas geworden.
Das "Volksheim" hat heute sein 25jähriges Jubiläum und es hat ein Recht darauf zu jubilieren, denn es hat seine Arbeit gut, klug, taktvoll, anspruchslos, klassenversöhnend begonnen und durchgeführt, eine der wenigen Wiener Einrichtungen, die im Laufe der Ereignisse nicht hat "umlernen" müssen.
Trotz der strahlenden Erfolge, die er meldet, ist der kleine Bericht im Mollton gehalten. Es könnte darüber als Motto stehen: "Ich alleine, der eine, schau wieder hernieder zur Saale im Tale, doch traurig und stumm." Professor Becke, vom ersten Tag an der Vorsitzende, und Emil Reich, ebensolang der Schriftführer, schreiben den Bericht und zwischen den trockenen Zeilen zittert die Empfindung: Jene, die das "Volksheim" mit uns geschaffen haben, sind nicht mehr. "Zu den Toten entboten", viel zu früh und sicher in einem gewissen Sinne [S. 61] Kriegsopfer einer Zeit, die für solche Geister und Charaktere keinen Platz hat.
In einer anderen Tonart spricht mein Herz vom "Volksheim", denn dieses stellt ein Stück meiner Jugend dar.
Das war aber auch ein ganz besonderer Frühling, der von 1901. Die Kastanien auf dem Heldenplatz waren röter als sonst, die Tulpen im Stadtpark noch stolzer. In der "Sezession" war Segantini3 ausgestellt und in den Herzen der Jugend regte sich eine große Sehnsucht nach einer neuen Form des Lebens und wirklich sah es so aus, als sollte ein Jahrhundert anfangen.
Da stand eines Morgens in der Zeitung wieder etwas Hoffnungsvolles. Auf dem Urban-Loritz-Platz sollte eine Volkshochschule entstehen. Arbeiter wollten ihre kargen Freistunden dazu verwenden, das Wissen, welches ihnen ein ungerechtes Schicksal vorenthalten, nachträglich zu erwerben. Hochschullehrer wollten sich die Mühe geben, ihre Wissenschaft so vorzutragen, daß schlichter Menschenverstand sich ohne weiteres daran bereichern konnte. Aber man brauchte nicht einmal ein Professor zu sein. Auch andere Leute, die was gelernt hatten, wurden aufgefordert, mitzutun.
Ich war begeistert. Bei so was Herrlichem dabei sein zu dürfen, schien mir ein Glück. Eine Stunde später stand ich vor Ludo Hartmann. Er sah mich sachlich an. Mir sank das Herz. Er fragte nach meinen Lehrerfahrungen. Ich hatte keine. Alle Reserve eines Historikers, der gewohnt ist, sich mit mittelalterlichen Päpsten zu beschäftigen, malte sich in den Zügen des verehrten Mannes. Zuletzt – irgend etwas an mir schien ihn zu rühren – sagte er: "Na also, probieren Sie’s. Aber machen Sie sich darauf gefaßt: Zu Ihnen werden nicht viele hineingehen."
Im Vorzimmer wartete schon ein junger Naturhistoriker. Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß da drinnen Jugend nicht im höchsten Kurse stünde. Er meinte resigniert: "Da läßt sich nichts machen. Für erwachsen kann ich mich nicht ausgeben". Und das konnte er auch nicht und kann’s glücklicherweise auch heute noch nicht, trotz Ablaufes der Zeit und Professorenwürde.
Dann kam der große Tag. Mit Todesangst betrat ich das mir zugewiesene Lehrkammerl. Sieben ältere Männer saßen darin und alle hatten sie wirkliche Menschengesichter. Der wunderbare Ernst und das große Wohlwollen meiner Hörer ließen mein unerträgliches Herzklopfen stiller werden. Ich schöpfte tief Atem und dann begann ich mit einem Vertrauen, das von Minute zu Minute wuchs, zu erzählen. Von den Dichtern, die mir die liebsten waren, von ihrem Arbeiterschicksal, von ihrem Kampf mit der Welt, von ihrem hohen Sieg. Das nächste Mal hatte ich 60 Schüler – eine erlesene Hörerschaft. Es war eine wirkliche Auswahl. Wer nach zehn-, elf-[S. 62]stündiger schwerer Tagesarbeit noch ins “Volksheim” kam, der taugte eben was. Und wovon immer man sprach, wenn es einem nur lebendig aus der Seele floß, wurde geahnt, verstanden, ausgebaut. Man konnte Tränen, Lachen und Begeisterung zum Lohn haben. Ein glücklich-regsames Leben herrschte in diesen Stunden, bei denen der junge Lehrer seine Weisheit aus den teilnahmsvollen Blicken seiner zumeist gealterten Schüler ablas.
Der unerwartete Erfolg verführte mein junges Herz. Hatte ich nicht kürzlich mein Doktorexamen in Germanistik gemacht? Und das war damals noch etwas. Denn zum Studieren mußte man von zu Hause durchgebrannt sein und außerdem hatte man sich den ganzen Tag von jedem Menschen anpöbeln zu lassen, der gegen das Frauenstudium war, und das war beinahe jeder.
Also meine Schüler sollten merken, was ich alles in Zürich gelernt hatte. Ich bereitete sorgfältig einen Vortrag vor und ließ über meine betäubten Zuhörer ein wahres Feuerwerk niederprasseln: vom Wesen des Anakoluths4, von der Analogiebildung und vom Sinnesvikariat. Das war das Feinste, was ich wußte. Alle waren wirklich paff, das konnte man schon merken.
Als ich nach der Stunde das “Volksheim” verließ, schloß sich mir ein alter Arbeiter an. Wir schritten schweigend durch die fliederduftende Vorstadt, ich das Herz hochgeschwellt von jungem Ruhm. Der alte Mann schwieg beharrlich. Allmählich wurde mir bange. Ich fühlte: Der ist nicht entzückt von dir; versuch ihn durch Teilnahme zu entwaffnen. "Sind Sie nicht müde, wenn Sie nach Ihrer Tagesarbeit so am Abend noch in die Schule geh'n?"– "Na nie! Aber heut' schon" – "Warum gerade heute?" – "Weil Sie so daherg’redt hab’n. Ich tät nix sagen, wenn Sie’s nicht besser könnten. Aber beim Tolstoi und bei dem Dostojewski, da war’n S‘ so aus’m Häusl, als wär’s Ihner Geliebter. Rührende Sachen hab’n S‘ erzählt und gelesen hab’n S‘, daß was zum Lachen war. Aber heute hab’n S‘ nur an sich denkt, aber an uns net." Nachdenklich ging ich nach Hause. Dort schlug ich zufällig ein Buch auf und da stand: "Wenn wir uns nur auf einen Augenblick von unserem winzigen Ich losmachen, wenn wir nur reines Glas sein wollten, welches die Strahlen widerspiegelt, wie vieles würden wir da widerspiegeln! Das ganze Weltgebäude würde sich im Strahlenglanze um uns herum ausbreiten." Ärgerlich schlug ich das Buch zu.
Am nächsten Tage schloß sich mir auf dem Heimweg ein jüngerer Arbeiter an. Er begann sofort zu sprechen: "Sie müssen mir nämlich einen Rat geben. Ich möcht‘ einen besseren Stil kriegen." – "Ja, das kann ich," sagte ich, "da müßte ich nur zuerst sehen, was und wie Sie schreiben; zeigen Sie mir, bitte, etwas." – "Ich trau‘ mich nicht recht. Ich hab‘ noch keinem was zeigen wollen." – "Schau’n Sie, zum Zeichen des Vertrauens zeige ich Ihnen, was ich schreibe." Ich drückte ihm ein sauberes Manuskript in die Hand, meinen eben verfaßten Artikel über Hugo Wolf für die "Neue Zürcher Zeitung".
Schon am nächsten Tage brachte er mir seine Sachen und meinen Artikel. Ich war höchst gespannt auf sein Lob. Sein Gesichtsausdruck war lustlos. Aber seine Worte klangen anerkennend. "Was Sie schreiben, könnt‘ von einem Mann sein." Ich dankte hocherfreut. Diese Anerkennung war im Züricher Studentinnenverein der höchste Orden. "Da ist nix zum Danken. Wenn Sie schreiben, wie ein Mann, was braucht man nachher Ihnen? Bei mir möcht’s mi giften, wenn Sie sagen: Es is von an Madl. Wenn auch nicht viel dran is an meinem Geschreibsel. Was i schreib‘, is von an Mann.” Mein getreuer Eckhart ist dann trotz oder vielleicht infolge meiner guten Ratschläge kein großer Schriftsteller geworden. Ich aber weiß seither bei jeder Zeile, die ich schreibe, daß ich ein Madl bin.
Als mich wachsende Berufstätigkeit zwang, das geliebte "Volksheim" zu verlassen, blieb in mir eine stete Sehnsucht nach jener schönen und reinen geistigen Gemeinschaft, aufgebaut [S. 63] auf dem Grunde eines unverbildeten und aufrichtigen Wissenshungers. Dankbar war mir bewußt, was ich im “Volksheim” gelernt hatte. Daß dort bei mir jemand etwas gelernt hätte, glaubte ich nicht. Und doch war es so.
November 1918, wenige Tage nach dem Umsturz. Ich wartete in einer Angelegenheit der Wiener Kinder im Vorzimmer eines Staatsmannes und machte mich dem ganzen Antichambre, welches mich um jeden Preis loswerden wollte, durch beharrliches schweigendes Warten lästig. Da öffnete plötzlich der Mann selbst die Tür, erblickte mich, zog mich freudig ins Zimmer und sagte: "Ich war nämlich Ihr Schüler im "Volksheim" Und nun erzählte er mir von Eindrücken jener unvergeßlichen Zeit, ihren Anregungen und Anknüpfungen und wie diese auf sein ganzes Leben bestimmend gewirkt hätten. So hielt er an einem nüchternen, trüben Vormittag in einer Amtsstube die allerschönste Festrede auf das "Volksheim". Glücklich ergriffen hörte ich zu. Da schloß er: "Ich habe seither manchen Erfolg in meinem Leben gehabt, keinen schöneren aber als meinen ersten im "Volksheim". In Ihren Stunden hatten wir Vorträge zu halten, und da wurde in der nachfolgenden Diskussion jeder nach Inhalt und Form schonungslos zerpflückt. Auch ich hielt einen Vortrag, und zwar über ein Thema, das mir sehr am Herzen lag. Als ich zu Ende war, wartete ich zitternd – ich war erst sechzehn Jahre alt und der weitaus Jüngste – auf mein Urteil. Da sagten Sie entschlossen: “Heute gibt’s keine Diskussion, das war zu schön." So stolz hat mich seither nichts wieder gemacht.
"Das verstehe ich. Der alte Konrad Ferdinand Meyer hat recht: Denn Süß’res gibt es auf der Erde nicht, als ersten Ruhmes zartes Morgenlicht, aber Sie haben Ihre Sache damals sicher auch sehr schön gemacht, und daß ich so viel Verstand hatte, nicht diskutieren zu lassen, freut mich noch heute", erwiderte ich. "Ja, es war recht von Ihnen", sagte er und sah mich freundlich an. "Ja, recht war es schon, aber es war nicht mein Verdienst, denn im alten "Volksheim" wehte eine Lebensluft, die einen zwang, das Rechte zu tun".
Und die weht noch heute darin. [S. 64]
(Wortwahl, Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung entsprechen dem Original. Die im Original durch Sperrung hervorgehobenen Wörter wurden kursiv gesetzt. In eckiger Klammer steht die Zahl der jeweiligen Seite des Originaltextes. Offensichtliche Druckfehler wurden berichtigt.)